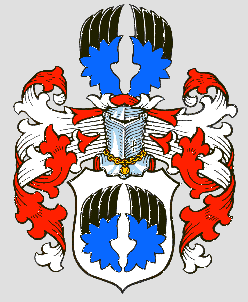
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Existenzgründung |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
Meine Mutter hatte keinerlei Verständnis für den Wunsch von Elisabeth und mir, Kinder zu bekommen. Das sei unverantwortlich, denn man wisse nicht, wie in dem chaotischen Mitteleuropa die Zukunft aussehen werde. Unsere Großfamilie solle für die vorhandenen Kinder sorgen und nicht noch neue in die Welt setzen. Das war ihre Meinung. Trotzdem war es für sie selbstverständlich, zu uns nach Göttingen zu kommen und zu helfen, wo sie konnte, als sich bei Elisabeth die Geburt unseres ersten Kindes angekündigt hatte. Meine junge Frau war gerade dabei, unsere winzige Zweizimmerwohnung aufzuwischen, als die Wehen einsetzten und ich sie schleunigst in die nahe gynäkologische Privatklinik bringen mußte. Wir gingen zu Fuß die Weender Straße entlang, bogen rechts in den Kreuzbergring ein. Sie solle langsamer gehen und sich mehr auf meinen Arm stützen, sagte ich. Diese Ermahnung half nicht. Mit schnellen, kraftvollen Schritten erreichten wir die Klinik am Kirchweg, wo ich Elisabeth gut aufgehoben wußte. Zur Geburt unseres ersten Kindes überließ ich sie den fürsorglichen katholischen Schwestern. Da wir kein Telefon in unserer Wohnung hatten, ging ich zu meinen Schwiegereltern, die immer noch am Kreuzbergring wohnten, und wartete dort auf den erlösenden Anruf. Erst spät in der Nacht, als ich gerade in einen unruhigen Schlaf gesunken war, schrillte das Telefon. Eine Frauenstimme, es war wohl die Nachtschwester, sagte: "Ihre Frau ist gerade [318] von einem Sohn entbunden worden. Mutter und Kind sind gesund." Vielen Dank, Schwester, ich könnte Ihnen um den Hals fallen. Sie glauben nicht, wie schwer es für den Vater ist, einen Sohn zu bekommen. Am nächsten Morgen ging ich zur Klinik, stürzte in das Zimmer, in dem Elisabeth lag, bedankte mich bei ihr mit einem großen Blumenstrauß und einem dicken Kuß. Die Schwester brachte uns unseren kräftigen Sohn, der für mein Gefühl enttäuschend verknautscht und verfärbt aussah, was ich mir natürlich vor der jungen Mutter nicht anmerken ließ. Er soll Matthias, Horst, Joachim heißen, war unsere übereinstimmende Meinung. Zu Hause in dieser ärmlich möblierten Mietwohnung, in der nur ein schmiedeeiserner Kacheltisch, eine Stehlampe und eine Kochkommode unser Eigentum war, versorgte meine Mutter den strapazierten Vater mit dem ihr eigenen Können einer Hausfrau, die zeitlebens einem großen Landhaushalt vorgestanden hatte, jetzt aber mangels entsprechender Vorräte und Kücheneinrichtungen unsere kargen Mahlzeiten zubereitete. Der Elektrokocher wurde nach Benutzung dergestalt in das Vielzweckmöbel hineingeschoben, daß unsere Wohnung nach beendeter Mahlzeit und nach dem Abwasch in einer Blechschüssel sich wieder in ein gemütliches Wohnzimmer verwandelte. Wozu ist eigentlich der ganze Komfort nützlich? ging mir durch den Kopf. Die Tage in der liebevollen Obhut meiner Mutter, im Bewußtsein, Vater eines Sohnes und Ehemann einer lebenstüchtigen Frau zu sein, ließ in mir ein Gefühl des Glücks und der Geborgenheit wachsen, das ich nur im Kreise der Familie, der engsten mir vertrauten Menschen empfinde. Seitdem war ich von dem festen, unumstößlichen Willen beseelt, die existenzielle Grundlage für eine eigene Familie zu schaffen. Das Streben nach einer Familie bedeutet zunächst und vorrangig, daß Geld in die Haushaltskasse kommen muß. So bemühte ich mich in der nächsten Zeit um eine berufliche Position, die eine sicherere Basis für meine Familie darstellt, [319] als es die Agrarsoziale Gesellschaft sein konnte. Durch mein Studium hatte ich mich für eine höhere Beamtenlaufbahn qualifiziert. Die vorhandenen Stellen im öffentlichen Dienst waren in den Verwaltungen der britischen und amerikanischen Besatzungszonen, in den beiden neu konstituierten Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein voll besetzt. Die Bundesrepublik Deutschland bestand noch nicht. Eine Entnazifizierung zu erhalten, war für mich kein Problem, denn ich konnte mit reinem Gewissen der entsprechenden Kommission in Göttingen versichern, niemals Parteimitglied gewesen zu sein. Meiner Herkunft gemäß wollte ich in einem norddeutschen Agrarland bleiben. Ich bewarb mich bei der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung um eine Referendarstelle in der Landeskulturverwaltung, leider ohne Erfolg. Die Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft, die damals ihren Sitz in Hannoversch-Münden hatte, wollte mich nicht einstellen, weil ich kein Mitglied der Sozialdemokratischen Partei war. Ohne Beziehungen zu einflußreichen Leuten und ohne Mitgliedschaft in einer Partei schien es mir unmöglich zu sein, eine Position im öffentlichen Dienst zu erlangen. Obwohl in der Zeit die Chancen für landwirtschaftliche Berufe wegen der Unzahl von Flüchtlingen aus Ostdeutschland und dem sich täglich steigernden Menschenstrom aus Mitteldeutschland äußerst gering waren, schrieb ich weiterhin Bewerbungen. In jener Zeit herrschte ein erbitterter Überlebenskampf. Auf dem schwarzen Markt war kein Geld mehr zu verdienen. Die sozialen Spannungen zwischen den Flüchtlingen, Ausgebombten, Kriegsgeschädigten und denjenigen, die ihr Eigentum, ihr Haus und ihre Existenz behalten hatten, steigerten sich. Dies war eine Zeit, in der die kriegsgeschädigten Familien näher zusammenrückten und um Ernährung, Kleidung und Wohnung kämpften. Zwischen Flüchtlingen und Einheimischen, zwischen Bauern und Städtern, Erzeugern und Verbrauchern, Sachwertbesitzern und Enteigneten fand keine Annäherung, [320] nicht einmal ein sachliches Gespräch statt. Die Gruppen begannen, sich zu organisieren, und bemühten sich, politischen Einfluß zu gewinnen. Ich sagte zu mir: Alter Freund, wenn Du Dich durchsetzen willst, dann erkenne die Lage, schätze Deine Stärken und Defekte richtig ein und gehe ruhig und systematisch zu Werke. Ich kannte aus der Agrarsozialen Gesellschaft den Gewerkschaftssekretär Heinz Frehsee, der als Arbeitnehmervertreter zum Vizepräsidenten der Vorläufigen Landwirtschaftskammer Hannover gewählt worden war. Er sagte mir, ich solle mich um eine Stelle in der im Aufbau befindlichen landwirtschaftlichen Selbstverwaltungskörperschaft bewerben. Das tat ich und wurde gebeten, mich zu einem Gespräch in Hannover einzufinden. Es fand bei Edmund Rehwinkel statt, der Vorsitzender des Verbandes des Niedersächsischen Landvolks und Präsident der Vorläufigen Landwirtschaftskammer Hannover war. Das Präsidentenzimmer in einer angemieteten Privatvilla an der Hohenzollernstraße war enttäuschend. Den ehemaligen Salon hatte man mit einer provisorischen Wand unterteilt und karg möbliert. Rehwinkel saß hinter einem Schreibtisch, als ich eintrat. Er stand auf und forderte mich mit einer freundlichen Kopfbewegung auf, Platz zu nehmen. "Sie haben sich um eine Stelle bei der Landwirtschaftskammer beworben. Sagen Sie mir, welche Vorstellungen Sie von Ihrer zukünftigen Arbeit bei uns haben", eröffnete er unser Gespräch. Ich kannte die konservative Einstellung meines Gegenübers und wußte, daß er ein harter, oft rauhbeiniger Kämpfer für die Interessen seiner Bauern war. Mir gegenüber gab er sich jovial, fast väterlich. Seine kleinen, listigen Augen unter dem mächtigen Schädel verrieten Sinn für Humor und intelligente, offene Gespräche. Er machte den Eindruck eines klugen, knorrigen niedersächsischen Bauern, der sich neugierig danach erkundigte, ob er mit dem Jungen Mann werde zusammenarbeiten können. Ich mußte auf der Hut sein und begann mit einem unverfänglichen Bericht über meine Herkunft, meine Berufsausbildung, die von mir verfaßten wissenschaft[321]lichen Arbeiten und meine fachlichen Interessenschwerpunkte. "Das genügt, dafür habe ich Verständnis." Wie, dachte ich, das kann er verstehen? Ob er wohl ein Interesse für die Lösung der Sozialprobleme in der Landwirtschaft und die Notwendigkeit einer Agrarstrukturreform vortäuscht, nur um mich aus der Reserve zu locken? "Ja, wir müssen etwas gegen die Landflucht tun", sagte er. "Letzten Endes geht es um die gerechte Entlohnung für die bäuerliche Arbeit." Er erkundigte sich, was ich von der Ebene der Beratung her tun zu können glaube, um dieses Problem zu lösen. Dann hörte er nur wenige Minuten zu, als ich mich beeilte, etwas Kritisches zum weitverbreiteten Gesindewesen zu sagen, und einige Bemerkungen über die Notwendigkeit, landwirtschaftliche Facharbeiter auszubilden, den Landarbeitereigenheimbau zu fördern, loswerden wollte. Dies seien Maßnahmen, die von der Landwirtschaftskammer durch Information und Beratung vorangetrieben werden sollten. Dann unterbrach mich Rehwinkel und begründete mit wenigen Sätzen, warum die Agrarfrage nur mit politischen Mitteln zu lösen sei. Die Landwirtschaft habe im freien Markt eine starke Position, da ihre Produkte immer noch knapp seien. Der Markt müsse daher von allen dirigistischen Eingriffen des Staates befreit werden. Er wußte, daß ich nicht für eine liberalisierte Ernährungswirtschaft war, denn ich hatte mich kurz vorher im Pressedienst der Agrarsozialen Gesellschaft unter dem Stichwort "Marktgemeinschaften" für ein Marktordnungsgesetz ausgesprochen. In meiner Doktorarbeit hatte ich mich für das Organisationsmodell "Selbstverwaltung mit kooperativer Wirtschaftstätigkeit" nach dem Vorbild der englischen "Marketing boards" eingesetzt. Rehwinkel beobachtete aufmerksam meine Reaktion. Die Möglichkeiten, durch Beratung Familienbetriebe zu entwickeln und zu rationalisieren, die ich ansprach, schien er zu überhören. Jedenfalls gewann ich den Eindruck, daß er nicht lange zu[322]hören konnte und lieber selber sprach. Ich mußte darauf achten, überhaupt noch zu Wort zu kommen. Er redete über die Agrarpolitik und das Programm des Bauernverbandes. Hohe landwirtschaftliche Erzeugerpreise seien wie ein warmer Frühlingsregen für die Bauern, war ein Satz, der in meiner Erinnerung haften geblieben ist. Ein anderer: "Wer großes Vermögen erhalten will, muß sich für das Eigentum des kleinen Mannes einsetzen." Das war eine Spitze gegen den ungezügelten Kapitalismus der Großindustrie, dachte ich und nickte zustimmend. Rehwinkels Sprache war bilderreich und in großen Bauernversammlungen sicher sehr überzeugend. "Sie haben doch Agrarpolitik studiert", sagte er und fragte, ob ich denn zu seinen Thesen nichts zu bemerken hätte. Nein, ich habe nicht. Auf dieses Glatteis konnte er mich nicht locken. Das sei auch gut so, bemerkte er beiläufig, denn die Arbeitsbedingungen und Landarbeiterlöhne werden vom Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft in Tarifverhandlungen vereinbart und die agrarpolitische Interessenvertretung sei Sache des Landvolkverbandes. Dies alles sei nicht Aufgabe der Landwirtschaftskammer. Ich müsse die Kompetenzen der Kreislandwirte beachten, die in der Regel Vorsitzende der Kreislandvolkverbände seien. Ohne ihre Zustimmung würde ich auf Kreisebene mit meiner Beratungstätigkeit nicht vorankommen. Gewiß, er sprach viel, und ich hatte Mühe, eine Bemerkung loszuwerden, aber von der Kraftmeierei, der Kompromißlosigkeit, dem verstockten Konservatismus, die ihm nachgesagt wurden, war nichts zu spüren. Er begegnete mir, dem Anfänger, dem Heimatlosen, dem entwurzelten Theoretiker, der noch keine Beratungserfahrungen vorzuweisen hatte, als der überlegene Agrarpolitiker mit einem taktvollen Respekt. Das gefiel mir, es befriedigte meinen Ehrgeiz. "Ich werde beim Herrn Kammerdirektor Dr. Körner Ihre Einstellung veranlassen und glaube, keinen Fehlgriff getan zu haben", murmelte er mehr zu sich, als zu mir gekehrt. Damit war ich entlassen. [323] Am 15. Mai 1950 hatte der Herr Kammerdirektor folgendes Schreiben an mich diktiert: Herrn Diplomlandwirt Dr. Horst Krüger Unter Bezugnahme auf Ihre Besprechung vom sechsten dieses Monats bei dem Herrn Präsidenten Rehwinkel und dem Unterzeichneten teilen wir Ihnen mit, daß wir bereit sind, Sie in die Dienste der Vorläufigen Landwirtschaftskammer zu übernehmen. Die näheren Einzelheiten Ihres Einsatzes als Sachbearbeiter für Sozialwesen möchten wir jedoch gern mit Herrn Vizepräsident Frehsee besprechen, der Abschrift dieses Schreibens erhält. Als Zeitpunkt der Einstellung wollen wir den 1. oder 15. Juni dieses Jahres in Aussicht nehmen. im Auftrage: Die Dienstbezüge richteten sich nach der Tarifordnung für Angestellte im öffentlichen Dienst und betrugen monatlich vierhundertfünfunddreißig Mark brutto. Es hatte mir bisher noch niemals an einem nach meiner Beurteilung gesunden, in den Augen von Elisabeth übersteigerten Selbstbewußtsein gefehlt. Die Basis für eine solide Existenz war nun vorhanden. Bei der gegebenen Lage, die Konrad Adenauer, der sich inzwischen mit seiner eigenen Stimme zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt hatte, oft und überzeugend als ernst, aber nicht hoffnungslos, gekennzeichnet hatte, konnte ich kein höher gestecktes Ziel erreichen. Mein Vater hatte bei allen möglichen Anlässen gesagt, der Spatz in der Hand sei ihm lieber als die Taube auf dem Dach. Ich verhielt mich entsprechend und war glücklich darüber. Das Haushaltsgeld für meine kleine Familie in Göttingen war knapp bemessen, aber von jetzt ab gesichert. In der ersten Zeit meiner Tätigkeit bei der Landwirtschaftskammer saß ich in einer kleinen Baracke, die auf dem Trümmergrundstück der Industrie- und Handelskammer am Schiffgraben stand. Ihr Hauptgebäude war ebenso wie das der Landwirt [324]schaftskammer den Bombenangriffen zum Opfer gefallen. Unsere Verwaltung war provisorisch in der Hohenzollernstraße in dem Haus untergebracht, in dem ich mich bei Rehwinkel vorgestellt hatte. Ihm und dem Kammerdirektor Dr. Körner ist es zu verdanken, daß zuerst das Grundstück der Landwirtschaftskammer an der Johannssenstraße, Ecke Schiffgraben aufgeräumt und Geld für den Neubau eines Kammergebäudes zurückgelegt wurde. Bis zum Neubau des Verwaltungsgebäudes mußte ich mehrmals in angemietete Räume umziehen, die über das gesamte Stadtgebiet von Hannover verteilt waren. Als ich in einem Geschäftshaus in der Osterstraße, in dem sich unten ein Möbelgeschäft befand, in der vierten Etage neue Diensträume bezog, wurde ich zum Referenten befördert. Von jetzt ab konnte ich mit einigen Mitarbeitern eine mir sinnvoll erscheinende Beratungstätigkeit entwickeln. Gleichzeitig stufte man mich in die unterste Besoldungsgruppe des höheren Dienstes ein. Der Niedersächsische Landtag beschloß ein Gesetz zur Bildung von zwei Landwirtschaftskammern in Niedersachsen. Damit entfiel die Vorläufigkeit meiner Dienststelle. Elisabeth und Matthias zogen in eine Mietwohnung in Hannover um. Das Leben begann sich bei uns ebenso wie in den Familien meiner Geschwister zu normalisieren. |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|