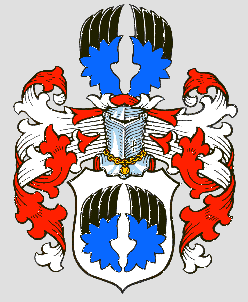
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Zeit ist Geld |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
Bei dem Umzug nach Hannover stellte uns mein Schwiegervater einen Lastwagen der Firma Siemens zur Verfügung. Unsere Möbel nahmen bei dem Umzug nur einen winzig kleinen Teil der Ladefläche ein. Als wir in Hannover-Wülfel vor dem neu erbauten Wohnhaus standen, in dem wir eine Mansardenwohnung gemietet hatten, fragte der Chauffeur, ob er unsere Klamotten herauftragen solle. Die Treppe sei ja noch nicht einmal fertig, und auf den schrägen Bohlen, die auf den rohen Betonstufen liegen, könne man allzu leicht ausrutschen. Als wir ihn dazu bewegen konnten, nur mit einem leichten Möbelstück den halsbrecherischen Aufstieg in die erste Etage zu wagen, sagte er an der offenstehenden Wohnungstür mit einem Tonfall, in dem sich Überraschung, Bewunderung und Neid [325] mischten, ob ich in den drei großen Räumen mit meiner Frau und nur einem Kind wohnen könne. Wir zeigten ihm die Kochnische, die mit einem Vorhang vom Wohnzimmer abgeteilt war. In sie solle er unser wichtigstes Möbelstück, die Kochkommode, stellen. Wir gingen dann in das Badezimmer, in dem außer dem Klo und einem Handwaschbecken nur eine Badewanne stand. Eine Therme oder ein Badeofen, mit denen man das Wasser hätte anwärmen können, war nicht vorhanden. Das WC hatte noch keinen Abfluß. Wir gingen in den ersten Wochen auf das Maurerklosett, das im Freien stand. Wenn ich nachträglich die Wohnverhältnisse meiner kleinen Familie in Göttingen bewerte, so hatten sie nicht nur Schattenseiten. Wir haben uns in den kleinen zwei Zimmern sehr wohl gefühlt. Matthias wurde dort geboren, ich erzählte es schon, und wir hatten oft Freunde zu Besuch. Wir waren damals, obwohl die Wohnung eng war, in der Lage, unseren Freund Peter Schilke zu beherbergen, der mein Nachfolger als Geschäftsführer der Agrarsozialen Gesellschaft geworden war. Wenn ich die Woche über in Hannover arbeitete, bezog er meine Bettcouch. Im Nachbarzimmer schliefen Elisabeth und Matthias. Ich empfand es manchmal als anstößig, wenn ich am Sonnabend abend mein Bettzeug aus dem Kasten der Couch herausholte und dabei Peters Schlafanzug herausfiel. Eifersüchtig war ich nicht. Ich hätte für Elisabeth und Peter die Hand ins Feuer gelegt, aber etwas mulmig war es mir schon in der Magengegend. In den fünfziger Jahren legte ich in meiner Tätigkeit bei der Landwirtschaftskammer Hannover den Schwerpunkt auf die rationellere Gestaltung der Landarbeit. Der Punkt, von dem aus ich glaubte, einen sinnvollen Beitrag zur Problemlösung in der Landwirtschaft meines großen Dienstbezirks leisten zu können, war die Produktivitätssteigerung der Arbeit auf dem Bauernhof. Wir werteten Arbeitstagebücher aus, machten Arbeitsvoranschläge, führten Arbeitsstudien mit der Stoppuhr durch, gründeten Arbeitsgemeinschaften von Landwirten und Beratern zur Auswertung der Daten, setzten die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis um, schrieben Artikel in der [326] Fachpresse und hielten Vorträge bei den Beratungsringen und Landwirtschaftsvereinen. Obwohl es mich lockt, zu den Inhalten der arbeitswirtschaftlichen Beratung, wie wir sie nannten, mehr zu erzählen, muß ich es mir versagen. An dieser Stelle soll nur über einige Höhepunkte meiner Beratungstätigkeit berichtet werden. So reisten eines Tages einundzwanzig führende Landwirte und achtzehn Berater nach Barsinghausen bei Hannover, um vom 4. bis 7. Januar 1956 in einem Internat an dem ersten von uns durchgeführten arbeitswirtschaftlichen Lehrgang teilzunehmen. Einige in langjähriger Betriebsführung erfahrene und tüchtige Bauern fanden sich, wenn nicht gerade auf der Schulbank, so doch auf harten Seminarstühlen eines mit Bildwerfern, Filmprojektor, Leinwand und Tafel ausgestatteten Lehrsaales wieder. Die Thesen, die wir Referenten vortrugen, gingen von der Voraussetzung aus, daß durch die Rationalisierung der Landarbeit die Lebensbedingungen aller in der Landwirtschaft tätigen Menschen verbessert werden können. Uns ging es darum, den praktischen Landwirten und vor Ort tätigen Beratern einzuhämmern, daß die Arbeitsabläufe zwar zu mechanisieren, aber vor jeder Maschinenanschaffung die sechs Rationalisierungsfragen zu stellen seien: Was, Warum, Wie, Wo, Wer, Wann. Wir wollten die Seminarteilnehmer befähigen, in ihren Betrieben den "alten Trott" und die "Betriebsblindheit" zu überwinden und sich den überlieferten Arbeitsabläufen und Arbeitsverfahren gegenüber kritisch einzustellen. Dabei versuchten wir, die in der Industrie praktizierten Methoden des Arbeitsstudiums auch in der Landwirtschaft einzuführen. Der erste Vortrag wurde von dem Geschäftsführer des regionalen "Verbandes für Arbeitsstudien" gehalten. Danach folgte eine Aussprache. Der Redner hatte genügend Ansatzpunkte für die Landwirte geboten, Einwände loszuwerden: "Ja. gut und schön, aber was in der Industrie möglich ist, kann auf unseren Äckern nicht durchgeführt werden. Wir produzieren nicht unter einem Dach und sind von Wind, Regen und Klimaeinflüssen abhängig." Die weiteren Vorträge befaßten sich mit der Analyse der [327] Transportarbeiten auf dem Hof, mit der Arbeitsplatzgestaltung im Haushalt und in den Ställen sowie mit den menschlichen Beziehungen innerhalb der Familie, zwischen Unternehmer und Mitarbeitern. In der Diskussion des letzten Vortrags, der zum Thema "Mensch und Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb" gehalten wurde, kamen die Faktoren zur Sprache, die zu einer Verbesserung des Betriebsklimas beitragen, beispielsweise die Alternativen Patriarchat oder Partnerschaft, Einsatz von ausgebildeten Facharbeitern oder ledigen Hilfskräften, Werkwohnungs- oder Eigenheimbau für Landarbeiter, Stundenlohn oder Leistungslohn. Auf Wunsch der Teilnehmer wurde ein Bericht über den Lehrgang in einer Broschüre mit dem Titel "Zweckmäßig arbeiten - besser leben"(19) veröffentlicht und an alle Wirtschaftsberatungsstellen und Beratungsringe im Bereich der Landwirtschaftskammer Hannover verteilt. Das erste Seminar in Barsinghausen hatte bei den Landwirten und Beratern soviel Zustimmung gefunden, daß wir nach seinem Muster in den fünfziger und bis weit in die sechziger Jahre hinein sechs oder sieben Betriebsleiterlehrgänge je Jahr in Göttingen durchführten. Sie dauerten fünf Tage und konnten nur in den Monaten Januar und Februar stattfinden, weil dann die Landwirte von ihren Höfen abkömmlich waren. Vorträge und Diskussionen wechselten mit Betriebsbesichtigungen ab. An einem Tag wurden für einen Betrieb in zwei Gruppen Vorschläge für die Mechanisierung und rationellere Gestaltung der Hofwirtschaft erarbeitet. Verbesserungsvorschläge wurden zusammen mit den Investitionsplänen von je einem Sprecher der beiden Gruppen vorgetragen. Der Betriebsleiter, dessen Hof in dieser Weise auseinander gepflückt und wieder zusammengesetzt wurde, war anwesend und konnte sich zu den Vorschlägen äußern. Nicht gerade selten kam es zu peinlichen Situationen, nämlich dann, wenn von den Gruppensprechern vorgetragen wurde, daß man bei dem gegebenen Gebäudezustand keine andere Lösung gefunden hatte, als "warm abzubrechen" und danach mit einer neuen Grundrißplanung zu beginnen. In einigen Fällen wurden im Landkreis Göttingen [328] tatsächlich von uns untersuchte und theoretisch geplante Betriebe später aus dem Dorf ausgesiedelt und an arbeitswirtschaftlich zweckmäßigen Standorten neu aufgebaut. Ziel dieser Betriebsleiterlehrgänge und der sich daran anschließenden Einzelberatungen war es, die Arbeitsproduktivität der Landwirtschaft so zu steigern, wie es die Industrie bereits getan hatte. Das ist in den fünfziger und sechziger Jahren bei stark abnehmendem Arbeitskräftebestand und gleichzeitig steigender Produktion dann auch gelungen. Wir haben in der Landwirtschaft eine Produktivitätssteigerung erreicht, die über derjenigen mancher Industriezweige lag. Die "Grüne Front", wie die Landwirtschaft von den Medien damals bezeichnet wurde, hatte den Nachweis erbracht, im System der von Adenauer und Erhard eingeführten sozialen Marktwirtschaft zu schöpferischen, unternehmerischen Leistungen, zur Steigerung der Produktivität durch den wirtschaftlichen Einsatz der modernen Technik fähig zu sein. Sie hatte ihren Umstellungsprozeß nicht nur mit Hilfe der Grünen-Plan-Milliarden und des Marshallplanes finanziert, sondern den gigantischen Modernisierungsprozeß auch aus eigener Kraft heraus. Ein Höhepunkt meines Berufslebens war eine Studienreise in die Vereinigten Staaten, die ich zusammen mit dem damaligen Staatssekretär und späteren Hessischen Landwirtschaftsminister Dr. Tassilo Tröscher und dem Geschäftsführer der Agrarsozialen Gesellschaft, dem uns bereits bekannten Peter Schilke unternahm. Elisabeth fuhr mit Matthias, der inzwischen vier Jahre alt war, und Andreas, unserem zweiten Sohn, der in Hannover geboren wurde, zu meiner Mutter und meinen Schwestern nach Stubben. Noch heute ist es mir ein Rätsel, wie es insgesamt zehn Personen über vier Wochen fertiggebracht haben, sich in Ediths Haus nicht gegenseitig auf die Nerven zu fallen. Es sind wohl verträgliche Menschen gewesen, die es in der Nachkriegszeit gelernt hatten zusammenzurücken, und die Übel der zu großen Nähe sich nicht haben anmerken lassen. Elisabeth schrieb aus Stubben an ihre Großmutter und ihre beiden Tanten in Greifswald am 20. Okto[329]ber 1953 folgenden Brief: Meine liebe Oma! Schon lange sollte ein Brief an Euch abgehen, und nun will ich mich endlich zum Schreiben aufschwingen. Ich weiß nicht, ob ich Euch schon einmal davon schrieb, daß Horst gegenwärtig eine Studienreise in die Vereinigten Staaten macht. Am 22. September flog er von Frankfurt am Main ab über Paris, Irland, Neu-Schottland nach New York. Dort blieb er zwei Tage. Dann ging es nach Washington, von dort über Virginia nach Chicago und weiter in den Staat Iowa. Hier blieb er vierzehn Tage in Ames, einer Universitätsstadt. Jetzt ist er auf dem Weg nach Mississippi, wo er einige Tage bleiben wird. Dann will er weiter nach Arkansas fahren. Er schreibt sehr begeistert von allem, und wir sind sehr froh, daß er soviel erleben und sehen kann. Am meisten staunt er immer wieder über die vielen deutschstämmigen Amerikaner, die es drüben gibt. Mitte November erwarte ich ihn zurück. Ich fühle mich recht einsam und verlassen, aber jede noch so lange Zeit vergeht ja einmal. Ich bin kurz entschlossen und gegen meine ursprünglichen Pläne hierher gefahren, da die Kinder bei uns im Hause Keuchhusten bekommen haben und ich unsere möglichst davor bewahren wollte. Sie fühlen sich hier sehr wohl, da sie den ganzen Tag im Garten spielen können. Matthias sagte schon, er möchte tausend Tage hier bleiben. Der Hauptzweck unserer Reise war es, die Beratungsmethoden des Soziologie-Professors Stacy kennenzulernen, der in der Universität Ames als landwirtschaftlicher Berater tätig ist. Ich hoffte, Anregungen für die Beratung in Niedersachsen zu gewinnen. Nach wenigen Tagen war mir klar geworden: Die Vereinigten Staaten kann man nicht kopieren, man sollte sie kapieren. Bei meiner Reise hatte ich gesehen, wie meine Agronomenkollegen ausnahmslos in eigenen Häusern wohnten. Noch jenseits des Atlantiks entschloß ich mich, in Hannover ein Haus zu [330] bauen. Als Anette geboren war und wir für sie ein Plätzchen in unserer Mietwohnung suchten, geriet Elisabeth in ärgste Nöte. Im Badezimmer war immer noch kein Ofen. Die drei Kinder abends zu baden, war ein Umstand, den zu beschreiben eine halbe Druckseite füllen würde. Im Dienst beriet ich die Bauern, wie sie ihre Arbeitsabläufe rationeller gestalten sollten, ließ von meinen Mitarbeitern Transportflußpläne auf den Höfen erstellen. Dem Ist-Zustand wurde der Soll-Zustand gegenübergestellt. Die Planung der Verbesserungsvorschläge erfolgte nach dem Grundsatz: Was fließen kann, soll fließen, was rollen kann, soll rollen und nicht getragen werden. Als Elisabeth eines Tages wieder einmal das Badewasser für die Kinder auf dem Elektrokocher in der Kochnische heiß gemacht hatte und den schweren Kessel in das Badezimmer trug, sagte sie vorwurfsvoll, daß ich für die Bauernhöfe wunderschöne Rationalisierungspläne entwerfe, statt es mit den Hausbauplänen ernst zu machen. Schon damals war der Grundstückskauf im Nahverkehrsbereich von Hannover ein nicht leicht zu lösendes Problem. Wir fanden schließlich einen Bauern in Bothfeld, der bereit war, uns ein Stück Land zu einem günstigen Quadratmeterpreis von zwei Mark und fünfzig Pfennigen zu verkaufen. Da wir keine Ersparnisse hatten und auch noch keine Sicherheiten bieten konnten, lieh ich das Geld von meiner Schwester Ursula, die inzwischen über ein Bankkonto verfügte. Der Hausbau wurde dann mit Bankkrediten, zinsverbilligten Landesmitteln aus dem Fonds für den sozialen Wohnungsbau und Lastenausgleichsansprüchen für meinen Hof in Altthorn finanziert. Künftige Generationen der Familie sollen es wissen, daß nur der Bodenwert des fünfundsiebzig Hektar-Hofes mit zwei Mark fünfzig Pfennigen je Quadratmeter einen Verkehrswert von 1,875 Millionen Mark darstellt. Die Häuser, das lebende und das tote Inventar sind dabei nicht bewertet. Die Entschädigung nach dem Lastenausgleichsgesetz betrug 23.000,- Mark. Die Bewertung des Bodens mit zwei Mark fünfzig Pfennigen, mit dem Wert, den ich für das Grundstück in Hannover-Both[331]feld gezahlt hatte, ist nicht zu hoch, weil zu der Zeit, da diese Zeilen niedergeschrieben werden, der Preis für landwirtschaftlich genutzte Flächen vergleichbarer Güte in Niedersachsen bei fünf bis sechs Mark je Quadratmeter liegt. Für uns waren damals die Lastenausgleichsmittel eine hochwillkommene Finanzierungshilfe, ohne die wir das Wagnis, ein eigenes Haus zu bauen, nicht hätten eingehen können. Der Lastenausgleich ist ein Gesetzgebungswerk, das zur Eingliederung von vielen Millionen Ostdeutschen in die Gesellschaft der Bundesrepublik beigetragen hat. Unser Rechtsanspruch auf das Eigentum jenseits der Oder-Neiße-Linie ist damit aber nicht erloschen. Schon einige Monate nach Baubeginn konnten wir das Richtfest feiern. Dabei wurde folgende Urkunde in den Schornsteinsockel eingemauert: Im Frühjahr des Jahres 1956 haben wir mit dem Bau unseres Hauses begonnen. Wir mußten hier im Westen unseres geteilten Vaterlandes Existenz und Hausstand neu aufbauen. Unsere drei Kinder freuen sich auf das Haus und den Garten. Matthias, der Älteste, ist sieben Jahre alt, Andreas ist vier Jahre alt, und Anette ist ein Jahr alt. Wir grüßen den Finder dieser Urkunde. Gott möge dieses Haus beschirmen, unsere Familie segnen und uns den Frieden erhalten. Wir wünschen uns, daß dieses Haus eine Heimstätte der Hilfsbereitschaft, der Liebe und der Achtung vor dem Menschen sei. Im Oktober zogen wir in das neue Haus ein. Im November feierten wir mit meiner Mutter und der Großfamilie ein Einweihungsfest. Traditionsbewußt, wie wir damals waren, wollten wir an die großen Familienfeiern anknüpfen, die Elisabeth aus der Danziger und ich aus der Thorner Niederung kannten. Das gelang uns nicht wie erhofft. Der zündende Funke für ein rauschendes Fest sprang nicht über. Lieder zu singen, versuchten wir erst gar nicht. Elisabeth war dagegen, denn sie war der Meinung, daß unser Gesang nicht schön sei und nur unsere sentimentale Stimmung steigere. Meine Mutter hatte ihre Sachen aus Stubben mitgebracht. Sie sollte, so hatten ihre Kinder beschlossen, zukünftig bei uns [332] in Hannover wohnen. Ein Zimmer im oberen Stockwerk unseres Hauses war dafür mit Einbaumöbeln ausgestattet worden. Wir nannten ihr unter der Dachschräge stehendes Bett das Gänsenest. Zog man den Vorhang zu, der über ihm angebracht war, so verwandelte sich das kleine Zimmer in einen gemütlichen Wohnraum. Meine Mutter hatte ihm außer durch ein paar Bilder aus Altthorn nie eine persönliche Note gegeben. Heute bin ich mir dessen bewußt, daß sie, obwohl sie sechs Jahre in unserem Hause wohnte, sich nicht bei uns einleben wollte. Ihre zweite Heimat war Stubben, ihre beiden Töchter und ihre Enkel Rüdiger und Horst Dahlweid, Sybille und Renate Feldt. Wir hatten oft den Eindruck, daß es über ihre Kraft ging, mit uns in einem für ihre Begriffe kleinen Haus am Rand einer Großstadt zusammenzuleben. "Einen alten Baum verpflanzt man nicht", besagt eine Bauernregel. War es dies, oder waren unsere drei kleinen, sehr lebhaften Kinder zu anstrengend für sie? Wahrscheinlich spielten alle diese Faktoren eine Rolle. Jedenfalls, um auf unsere mißglückte Einweihungsfeier zurückzukommen, meine Mutter muß es geahnt haben, daß sie sich in Hannover nicht werde einleben können. Sie saß schweigend und bedrückt dabei, so als ob sie sagen wollte, Kinder, wenn Ihr mich doch da lassen würdet, wo ich auf meine alten Tage eine sinnvolle Aufgabe habe und wo man mich am nötigsten braucht. Sie sagte es nicht und fügte sich dem Beschluß ihrer beiden Töchter. Meine Amerika-Reise hatte mich in der Ansicht bestärkt, Zeit sei Geld. So lag es nahe, unser Haus so zu planen, daß die Hausfrau soweit wie möglich entlastet wird. In der Grundrißgestaltung hatte ich die Arbeitsplätze so einander zugeordnet, daß Elisabeth bei der Hausarbeit nur wenige Schritte zu gehen brauchte. Die Arbeitsplätze und das Spülbecken in der Küche waren in der richtigen Höhe angebracht worden. Das mag einem Laien unwichtig erscheinen, mir kam es auf die rationelle Gestaltung des kleinsten Details an. Obwohl wir uns mit dem Hausbau finanziell so verausgabt hatten, daß an die Anschaffung einer Waschmaschine, einer Tiefkühltruhe und anderer Haushaltsmaschinen nicht zu denken [333] war, hatte ich Plätze, auf denen diese zweifellos zweckmäßigen Geräte einmal stehen sollten, sorgfältigst festgelegt. Selbst die Geschirrspülmaschine hatte einen Standort in der Küche erhalten, obwohl deren Anschaffung damals außerhalb unserer Möglichkeiten lag. Elisabeth hatte soviel Rationalität ihres Mannes mehr bedrückt als erfreut. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal ihren Widerspruchsgeist gegen meine zukunftsweisende Planung bemerkt hatte. Sie lief beispielsweise beim Geschirrspülen und beim Wegstellen der sauberen Teller und Töpfe viel weitere Wege, als ich es vorausberechnet hatte. Da meine Mitarbeiter und ich zu der Zeit in vielen niedersächsischen Kuhställen Arbeitsstudien machten, hatten wir uns mehrere Stoppuhren angeschafft. Eines Tages brachte ich eine, die gerade entbehrlich war, mit nach Hause, um Elisabeth bei ihrer Hausarbeit mit verdeckter Stoppuhr zu beobachten. Dabei erlebte ich eine unerwartete Schlappe, wie seinerzeit mit dem Zählen ihrer Schritte, als sie Anettes Windeln zum Trocknen auf die Leine hängte und sie später abnahm, um sie in die Wickelkommode im Kinderzimmer zu legen, die in der ersten Etage unseres Hauses stand. Als erstes stoppte ich, wie sie den Tisch im Eßzimmer deckte. Sie trug dabei Anette auf der linken Hüfte und arbeitete nur mit der rechten Hand. Unsere Tochter hatte vor einem Hund panische Angst, den ich gerade angeschafft hatte, so daß sie mörderisch zu schreien anfing, wenn Elisabeth sie auf den Fußboden setzte. Weißt Du, fragte ich sie, wieviel Sekunden Du allein für das dreimalige Gehen von der Küche ins Eßzimmer benötigst? Und dann diese Zeitverschwendung für das Abnehmen und Zusammenfalten der bunten Zierdecke, die immer auf dem Tisch liegt. Das Auflegen der weißen Eßtischdecke und der Servietten kostet soundsoviel Sekunden. Hast Du schon jemals überlegt, wieviel tägliche Arbeitszeit Du einsparen würdest, wenn Du eine Plastikdecke verwenden und sie immer liegen lassen würdest. Sie brauchtest Du nur mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Wenn auf diese Weise alle Arbeitsvorgänge [334] der deutschen Hausfrauen rationalisiert würden, könnte unsere Volkswirtschaft unermeßlich viel produktiver sein. Das bißchen Haushalt wäre dann nicht mehr der Rede wert. "Hör doch damit auf", zischte mich Elisabeth an, "die Leier kenne ich zur Genüge." Zum Glück hat sie die Stoppuhr nicht entdeckt, dachte ich. "Du solltest", fuhr sie Anette drei Küsse auf die Wange drückend fort, "immer dann, wenn Du denkst, ich habe keine Zeit, Dir sagen, ich habe keine Liebe. Denn was Du liebst, dafür nimmst Du Dir Zeit." Ich wußte bisher nicht, daß ich mit einer Philosophin verheiratet bin und einer emanzipierten dazu, dachte ich, schwieg aber eisern. Es fiel mir sehr schwer, meine Gedanken vor Elisabeth zu verbergen. Diesmal gelang es mir. Du bist für rationelle Arbeitsmethoden weniger aufgeschlossen als meine Beratungsklienten, versuchte ich mich, noch matt zu wehren. "Dann geh zu Deinen Bauern", sagte sie, "und mache bei ihnen Arbeitsstudien mit der Stoppuhr. Wenn sie dadurch produktiver arbeiten, die deutsche Landwirtschaft in der Europäischen Gemeinschaft dadurch wettbewerbsfähiger wird und die Lebensmittelpreise sinken, so soll mir das recht sein. Wenn Ihr so große Erfolge in Euren Kuhställen habt und der Arbeitsbedarf in der Milchgewinnung auf ein Drittel gesenkt werden kann, wie Du sagst, so werden die Milchprodukte hoffentlich bald sehr viel billiger werden. Davon spüre ich aber noch nichts in meiner Haushaltskasse. Erst vor wenigen Tagen stieg der Preis für ein Kilogramm Butter wieder um dreißig Pfennige." Seitdem brachte ich die Stoppuhr, die Elisabeth glücklicherweise nicht entdeckt hatte, nie mehr mit nach Hause. Im Sommer 1959 luden Elisabeth und ich meine Abiturklasse zu uns nach Hannover ein. Außer sechs im Kriege gefallenen Mitschülern, der Ärztin Margarethe Naumann und Albert Kiok, der unter dem Namen Alberto de Sarrazin in Venezuela lebte, waren acht ehemalige Mitschüler und Mitschülerinnen, teil[335]weise mit ihren Ehepartnern, erschienen. Mein Bruder Hans-Joachim und Ursula, die sich auf unserem Abiturfest in Altthorn, wie ich es schon erzählt habe, näher kennengelernt hatten, waren auch gekommen. Das war übrigens unser letztes Beisammensein in diesem Kreis. Es fand vor einundzwanzig Jahren statt. Wir trafen uns in unserem Hause. Um fünf Uhr, als sich alle versammelt hatten, fuhren wir in Autos zu einer Gaststätte in der Innenstadt. Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel auf der Terrasse, von der aus man den gesamten Maschsee überblicken konnte, machten wir einen ausgedehnten Spaziergang. Wir aßen dann im Hochzeitszimmer gemeinsam Abendbrot und verlebten bei Musik, Tanz und vielem Erzählen einen sehr schönen Abend. Mein Bruder lud uns zu einer Runde Sekt ein. Es blieb nicht bei dem einen Glas. Hans-Joachim merkte, wie bei Elisabeth der Sekt zu wirken begann, und füllte ihr Glas zum zweiten und zum dritten Mal. Erst um zwei Uhr brachen wir zur Heimfahrt auf. Der Pastor Karl Hoffmann mit seiner Ehefrau, Hellmut Neumann, Elisabeth und ich wollten bei uns zu Hause das harmonische Treffen ausklingen lassen. Wir fuhren gemeinsam in ausgelassener Sektlaune zur Neuen Wietze. Der Pastor saß neben mir vorne im Auto, Frau Hoffmann, Elisabeth und Hellmut Neumann hinten. Ich beobachtete im Rückspiegel, wie mein Freund seinen Arm um Elisabeth legte und sie in heiterer Stimmung ihren Kopf an seine Schultern schmiegte. Leider konnte ich nur selten einen Blick in den Rückspiegel werfen, da ich auf den Straßenverkehr achten mußte. Was ich dann aber sah, genügte, in mir ein Gefühl anschwellen zu lassen, das ich bisher nicht gekannt hatte. Der sittenstrenge Pastor neben mir bemerkte meine Unruhe und sagte mit einem auf seiner westpreußischen Zunge gerollten R: "Horrrst, sei barrrmherrrzig." Ich ließ mir meine Eifersucht nicht anmerken. Auch dann nicht, als Hellmut mit Elisabeth Brüderschaft trank und sie mit einem langen, gefühlvollen Kuß besiegelte. |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|