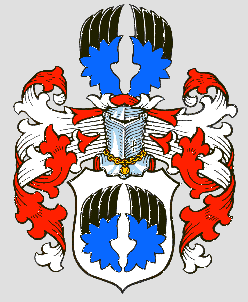
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Elisabeth |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
[263] Die Studenten der Landwirtschaftswissenschaften hatten mich zum Vorsitzenden ihrer Fachschaft gewählt. In dieser Eigenschaft oblag es mir, ihre Interessen der Universitätsverwaltung und dem Lehrkörper der naturwissenschaftlichen Fakultät gegenüber zu vertreten. Da studentische Verbindungen zwar wieder im Entstehen waren, aber sich noch nicht aktiv betätigten, organisierte ich für die Fachschaft Vortragsreihen und Gesellschaftsabende. Im Dezember 1946 kamen meine Freunde und ich auf die Idee, zu einer Adventsfeier mit anschließendem Tanz in ein Verbindungshaus in der Wilhelm-Weber-Straße einzuladen. Solche Absichten waren schon wiederholt am Mangel von Tee, Kaffee, Gebäck, Kerzen und Heizmaterial gescheitert. Wir überlegten, wie man trotz dieser Schwierigkeiten eine gesellige Veranstaltung zustande bringen könne. Da es zu der Zeit in Göttingen viele tanzsüchtige junge Damen gab, stellten wir ihnen als Veranstalter eine Teilnahmebedingung. Jede Eingeladene sollte Tee oder echten Kaffee oder Kuchen oder Weihnachtsgebäck oder eine Kerze oder ein Brikett mitbringen. Unsere Aufforderung fiel bei den jungen Damen und ihren Familien auf fruchtbaren Boden. Wir hatten eine lange Adventstafel gedeckt mit allen Genüssen, die sich ein ausgehungerter Student erträumt. Der Duft echten Kaffees durchwehte den Raum, das warme Licht der Kerzen erhellte ihn nur schwach, eine Kapelle von vier Medizinstudenten spielte Unterhaltungsmusik, als Peter Schilke und ich den stimmungsvollen Raum betraten. Mir fiel sofort eine junge Dame in einem grünen Kleid auf. Sie war mit einem anderen Studenten gekommen, neben dem sie bereits an der Kaffeetafel saß. Ich ging auf sie zu, begrüßte sie, nannte meinen Namen. Ihr Tischherr sagte: "Das ist Elisabeth Grünewald." Auf mich übte sie in ihrer Schüchternheit und Zurückhaltung eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Dieses Mädchen mußt Du näher kennenlernen, dachte ich. Ihre großen, braunen Augen, das schöne Gesicht, die weibliche Figur, alles an ihr ist rätselhaft. Ich beobachtete [264] sie möglichst unbemerkt. Der erste Eindruck hat Dich nicht getäuscht, dachte ich. Sie gefällt Dir, und warum fühlst Du Dich von ihr so angezogen? Erotische Ausstrahlung haben die anderen jungen Damen auch. Was ist es, was Dich zwingt, sie immer wieder anzusehen? Stell Dir keine Fragen, die Du nicht beantworten kannst. Sage Dir ganz einfach, es ist so, und damit basta, dachte ich. Wirst Du sie abgemagert und hohlwangig in Deinem grauen, blank gewetzten Anzug beeindrucken? Du mußt sie in ein Gespräch verwickeln. Was soll der Unsinn, Du mußt mir ihr tanzen. So sieht sie aus, ja, jetzt hast Du sie erkannt, sie wird gerne tanzen. Warum spielen die Medizinstudenten nur Unterhaltungsmusik? Sie sollen damit aufhören. Erst jetzt fiel mir auf, daß dort vier magere Gestalten, ebenso wie ich, in schäbigen, alten Anzügen standen, die sie vom Vater oder aus einer Kleiderspende geerbt hatten. Endlich begann der erste Tanz.Irgend jemand verkündete, die Damen mögen einen Schuh ausziehen und ihn in der Mitte der Tanzfläche hinlegen. Die Herren würden dann einen der Schuhe aufheben und hätten dadurch ihre Tanzpartnerin gewählt. Ich prägte mir die Schuhe ein, die Elisabeth trug, und beobachtete, wo sie den ihren hinlegte. Als die Bahn freigegeben wurde, stürzte ich zu dieser Stelle und hob zielsicher ihren Schuh auf, ehe ihn ein anderer wegschnappen konnte. Elisabeth tanzte gut, sehr gut sogar. Manchmal, das irritierte mich etwas, wenn ich aus dem Rhythmus fiel, zeigte sie die Neigung, mich zu korrigieren. Als der Tanz zu Ende war, führte ich sie nicht zu ihrem Tischherrn an die Kaffeetafel zurück. Wir blieben auf der Tanzfläche und stellten uns dann an ein offenes Fenster. Ich erinnere mich nicht mehr daran, was wir sprachen, aber sie begann, in unnachahmlicher und nicht beschreibbarer Weise mit mir zu flirten. Wir tanzten noch einige Male miteinander, ehe unser Adventsfest zu Ende ging. Wer begleitet Sie nach Hause? fragte ich Elisabeth. "Natürlich mein Tischherr, der mich ja auch eingeladen hat", war die kühle Antwort. [265] Hat es Ihnen ein klein wenig bei uns gefallen? wollte ich wissen. "Ja, sehr!" Mehr sagte sie nicht.Die Vorlesungen endeten kurz vor Weihnachten sechsundvierzig, und ich fuhr nach Bokel in die Ferien, ohne Elisabeth wiedergesehen zu haben. Bei meiner Mutter, meinen beiden Schwestern und den Neffen und Nichten erlebte ich das erste fast friedensmäßige Weihnachtsfest. Es war alles wie in Altthorn, der Weihnachtsbaum, Weihnachtsgebäck, kleine Geschenke und aufgeregte Kinder. Frau Terjunk und Tante Mimi taten, was ihnen möglich war, uns, die heimatlosen Flüchtlinge, zu erheitern. Beide Damen forderten mich auf, den Weihnachtsmann zu spielen, damit die Kinder das Fest genauso erleben, wie es gewesen wäre, wenn sie in ihrer Heimat geblieben wären. Ich sei, meinten sie, der einzige Mann im Hause und dürfe mich dieser Aufgabe nicht entziehen. Heiligabend kam heran. Der Weihnachtsbaum wurde angezündet, ich klopfte an die Zimmertür und trat ein. Die beiden Damen hatten mich mit Pelzmütze und einem langen Pelz so verkleidet, daß ich wie ein echter Knecht Ruprecht aussah. Die vier Kinder starrten mich mit großen Augen an. Ich fragte sie, ob sie auch schön artig gewesen seien, drohte mit der Rute, nahm den Sack vom Rücken und verteilte meine ärmlichen Geschenke, die aber eine riesengroße Freude auslösten. Die Kinder waren von meinen Sprüchen und meinem Gehabe halb eingeschüchtert und halb erfreut. Jedem, der ein Geschenk aus dem großen Sack bekam, gab ich einen herzhaften Kuß, auch der Frau Terjunk und der Tante Mimi. Das muß für die Damen und die Kinder kein reines Vergnügen gewesen sein, denn man hatte mir einen dicken Rauschebart angeklebt. Nur Renate, sie war damals drei Jahre alt, ließ sich durch die Rolle, die ich spielte, nicht täuschen. Sie beobachtete meine Gesten und meine Verkleidung kritisch. Plötzlich baute sich die kleine Person vor mir auf und rief mit trotziger Stimme: "Du bist gar nicht der Weihnachtsmann, Du bist der Onkel Horst." Und zu der im Kreis herumstehenden großen Hausgemeinschaft gewendet, sagte sie in triumphie [266]rendem Ton: "Ich habe ihn an seinen Schuhen erkannt."In diesen Weihnachtsferien hatte ich zum ersten Mal nach dem Kriege genügend Zeit, in die Werke der deutschen Klassiker hineinzusehen. Sie waren in dem Bücherschrank, den Frau Terjunk in ihrem Wohnzimmer stehen ließ, als sie es für meine Familie abgetreten hatte und mit ihrer Schwester in das obere Stockwerk gezogen war. Mir fiel dabei wieder ein, was ich bei Professor Brzeski gelernt hatte. Die Dichter der klassischen Epoche, besonders Friedrich von Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich von Kleist und Friedrich Hölderlin, hatten in ihren Anschauungen von der Welt, von der Kunst und Literatur sowohl den Rationalismus als auch den Gefühlsausbruch des Sturm und Drang überwunden. Sie übernahmen aber Wesentliches aus beiden Bewegungen und stützten sich in ihren philosophischen Aussagen auf Immanuel Kant. Mir fiel wieder ein, daß der große Königsberger in seiner Kritik der praktischen Vernunft die Grenzen der Gefühlswelt festgesetzt hatte. Das sittliche Tun dürfe nicht, so seine Kernaussage, auf Gefühl und Stimmung beruhen. Es müsse um seiner selbst willen geschehen und habe sich nur nach einer Norm zu richten: dem kategorischen Imperativ. Er sei jedem Menschen in sein Gewissen eingepflanzt. Ich blätterte wieder einmal den Faust durch und blieb gleich vorne bei der Zueignung, dem Vorspiel auf dem Theater und dem Prolog hängen: Gott überläßt Faust dem Mephisto: Solang' er auf der Erde lebt, Aber bei Goethe, in der Sinnenwelt Kleists, vor allen anderen in Schillers Dramen treten die großen Verführer auf, die ihre Helden vom rechten Weg abzubringen verstehen. Im Prolog zur Wallenstein-Trilogie heißt es: Denn seine Macht ist's, die sein Herz verführt. [267] Nicht nur Leidenschaften, Selbstsucht, Haß, Befehlsnotstand lenken den Menschen vom rechten Wege ab, auch eine transzendente Macht greift in das menschliche Schicksal ein. In Wallensteins Tod läßt Schiller seinen Helden sagen: Blieb in der Brust mir nicht der Wille frei, Könnte diese Worte nicht ebenso ein Hitler gesprochen haben? Ich las die Klassiker im Lichte meiner Erfahrungen und Erlebnisse mit gereiftem Verständnis. Sie waren es, die mich die Spuren der Transzendenz im menschlichen Leben wieder erkennen ließen. Ich hatte mich unter dem Einfluß der Philosophie Nietzsches in die Sackgasse einer Welt ohne Gott verrannt. Die schlichte Frömmigkeit, der ungebrochene Glaube, die Pflege christlicher Traditionen im Hause Terjunk und die deutsche klassische Literatur, die ich mir dort in die Erinnerung zurückrief, hatten eine Wende bewirkt. In Goethes West-Östlichem Diwan fand ich das Gedicht "Selige Sehnsucht". Es endet mit Worten, die mich tief berührten: Und solang' du das nicht hast, Nach den Weihnachtsferien fuhr ich nach Göttingen zurück. Ich hatte eine Abordnung französischer Agrarstudenten zu empfangen. Sie griffen meinen Vorschlag, am Abend das Göttinger Stadttheater zu besuchen, gerne auf. Wir setzten uns in eine der vorderen Reihen. Noch ehe sich der Vorhang hob, sah ich nur eine oder zwei Reihen hinter mir Elisabeth neben einem mir unbekannten Herrn sitzen. Ich verbeugte mich leicht, um ihr zu verstehen zu geben, daß ich sie be [268]merkt habe. Sie schien sehr erfreut über diese unerwartete Begegnung zu sein. In der Pause stellte ich mich an das Ende ihrer Sitzreihe und bat sie um ein Gespräch unter vier Augen. Sie fragte ihren Begleiter, ob er einverstanden sei. Er war es. Wo ich die ganze Zeit gewesen sei, wollte sie wissen, und warum ich inzwischen keine Begegnung mit ihr gesucht habe. Was sollte ich sagen? Um dem Kern ihrer Frage auszuweichen, erzählte ich etwas von den Weihnachtsferien, die ich in Bokel bei meiner Familie verlebt habe. Wenn sie es wolle, läge es bei ihr, schon in Kürze gemeinsam mit mir ein Faschingsfest in Nikolausberg zu besuchen. Elisabeth sagte zu, obwohl sie ihr Begleiter zu der gleichen Festivität eingeladen hatte. Irgendwie würde sie es ihm schon beibringen, daß sie verhindert sei.Unsere gemeinsam erlebten Feste waren der Ausdruck eines neuen Anfangs. Elisabeth kam jedes Mal mit einem anderen Kleid. Ich fragte sie, wie ihr das möglich sei, da es doch in den Geschäften nichts zu kaufen gäbe. Sie antwortete, in der Schneiderinnenlehre, die sie am 1. April 1946 begonnen habe, hätte sie gelernt, alte Kleider zu ändern. Im übrigen gelte ihr Interesse der Mode. Wenn sie die Gesellinnenprüfung gemacht habe, werde sie eine Modeschule besuchen. Tanzen, Feste feiern, Mode, das sind ihre Neigungen, dachte ich und verwarf alle aufkeimenden Hoffnungen, eine Partnerin gefunden zu haben, mit der ich einen Weg in eine gemeinsame Zukunft gehen könnte. Ich malte ihr in vielen Gesprächen, denn wir trafen uns fast täglich, wanderten auf dem Wall rund um die Altstadt von Göttingen, meine berufliche Zukunft in den düstersten Farben. Das war kein Zweckpessimismus von mir, denn ich wollte nach dem Diplomexamen noch promovieren, Volkswirtschaft und Gesellschaftswissenschaft studieren. Du bist, sagte ich bei einem dieser langen Spaziergänge, zum Tanzen geboren, und verglich sie in Gedanken mit meinen beiden Schwestern. Elisabeth machte keinen Versuch, sich bei mir in ein besseres, ich will lieber sagen, in ein anderes Licht zu rücken. Sie war nur traurig über mein hartes Urteil. Du liebst sie doch, [269] dachte ich. Warum quälst Du dieses liebebedürftige Mädchen, das in ihrer frühsten Kindheit ihre über alles geliebte Mutter verloren und mir bisher nur angedeutet hat, wie sehr sie ihre Erlebnisse auf der Flucht aus dem Osten bedrücken. Du siehst doch, daß sie alles vergessen und einen neuen Anfang machen möchte. Du findest es sehr schmeichelhaft, wie sehr sie Dir vertraut und daran glaubt, Du könntest der richtige Mann sein. Du hast den besten Willen, aber kommt es in meiner Lage darauf an? Du bist wie sie in einer fremden Umwelt, in der wir uns bewähren müssen. Wir haben ähnliche Erinnerungen. Ihre Mutter wuchs auf einem Bauernhof in der Danziger Niederung auf. Dort war sie nach deren frühem Tod oft bei den Großeltern in den Ferien. Die gemeinsame westpreußische Heimat verbindet uns. Dort war sie ein kleines, munteres, verspieltes Mädchen. Du möchtest sie auch verwöhnen, wie ihre Großmutter es getan hatte.Trotz dieser Gedanken, die mich immer wieder von neuem bewegten, sah ich es als meine Pflicht an, unsere Zuneigung zu ersticken, ehe eine Trennung uns noch schmerzlicher sein würde. Wir trafen uns aber immer wieder und taten diesen an sich notwendigen Schritt nicht. Unsere Gespräche drehten sich endlos um denselben Punkt. Oft stritten wir uns und verletzten uns, ohne es zu wollen. Elisabeth fragte mich: "Warum sollen wir uns denn, wenn es möglich ist, nicht treffen? Warum besuchst Du meine Eltern nicht?" Meine Antwort: Weil ich zuerst mein Studium beenden will. Ich brauche Zeit für die Diplomarbeit und zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Elisabeth entgegnete ungeduldig: "Du brauchst Deine Zeit für Dich, immer nur für Dich. Meine Eltern würden sich sehr freuen, Dich kennenzulernen. Denkst Du denn auch einmal an mich?" Ja, ich denke an Dich. Mehr, als es meinem Studium zuträglich ist. Das weißt Du ganz genau. Hör endlich mit diesen Vorwürfen auf. "Ich habe es doch nicht so gemeint", sagte Elisabeth in ver [270]söhnlich liebevollem Tonfall. "Du willst mich nicht verstehen."Ja, wirklich, Du hast recht, sagte ich. Ich kann Dich manchmal nicht verstehen. Ich muß einen klaren Kopf behalten. Wir haben doch kein Geld, eine engere Verbindung einzugehen. Wenn ich die Einladung zu Deinen Eltern annehme, bekommt unsere Beziehung einen offiziellen Charakter. Daran kann ich vorerst nicht denken. Verstehe mich doch. Und wenn ich die Diplomprüfung bestanden habe, dann kommt auch niemand und sagt zu mir 'Herr Krüger aus Bokel, auf Sie habe ich schon gewartet. Kommen Sie zu mir, ich gebe Ihnen eine gut bezahlte Stellung'. Elisabeth wurde böse: "Rede nicht so dummes Zeug. Wir sind jung, wir wollen beide arbeiten. Du denkst immer gleich an übermorgen. Du bist viel zu ernsthaft. Komm und laß uns ins Kino gehen oder über die Weender bummeln. Vielleicht treffen wir dort Freunde. Dann können wir etwas mit ihnen schwatzen." Resigniert vor soviel Unbekümmertheit sagte ich: So einfach, wie Du glaubst, ist das alles nicht. Man spricht davon, es werde bald eine Währungsreform geben. Wer weiß, wieviel dann mein erspartes Geld wert sein wird. Ich muß es meinem Bruder Werner überweisen. Der will es in seiner Firma in Lagerbeständen anlegen und es mir nach einer Währungsreform eins zu eins zurückzahlen. Nur wenn das klappt und ich meine zwei Pferde loswerde, kann ich weiter studieren. "Sei kein Frosch", sagte Elisabeth. "Du quälst mich mit Deinem tierischen Ernst. Nimm's nicht so schwer." Na gut, sagte ich, wann soll ich Deine Eltern besuchen, und wenn ich es tue, dann ganz kurz, nur zum Kennenlernen. Dein Vater soll ein sehr strenger Herr sein, habe ich gehört. Ist der denn überhaupt daran interessiert, mich armen Studenten mit meiner blank gewetzten Hose zu empfangen? "Natürlich ist er das", sagte sie. "Sei nicht dumm und komme übermorgen abend." So ging das oft stundenlang. Wir wollten einen Bruch vermeiden, lenkten ein, wenn unsere Gedanken zu hart aufeinan [271]der stießen, und vertrugen uns zum Schluß immer wieder. Wenn ich schon überhaupt keine Reibungspunkte mehr fand, hatte ich immer noch einen Pfeil im Köcher. Der wirkte todsicher. Ich brauchte nur anzudeuten, daß sie sich mir um den Hals geworfen habe, dann war sie in ihrer weiblichen Ehre gekränkt. Ich sagte dann zu ihr, sie hätte mir auf dem Heimweg von unserem ersten gemeinsamen Fakultätsfest in Grone, als wir Hand in Hand nach Hause gingen, plötzlich einen Kuß auf den Mund gegeben. Sie wurde dann böse und entgegnete, ich wäre es gewesen, der ihr den ersten Kuß gegeben habe. Wie war es wirklich? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wer von uns dem anderen um einige Zentimeter mehr entgegengekommen war. Im Grunde wollte Elisabeth mich zu nichts verführen, was ich nicht nach Lage der Dinge verantworten konnte. Wir versöhnten uns immer wieder und halfen uns mit diesen Streitereien gegenseitig über die Runden.Einige Tage danach lud ich Elisabeth ein, mit mir nach Hannoversch-Münden zu fahren. Sie solle Badezeug mitnehmen, denn ich fände es sehr schön, wenn die Witterung es erlaube, einen Tag lang an der Weser zu verbringen. Elisabeth war einverstanden. Wir fuhren mit dem Zug frühmorgens in Göttingen ab. Es war Sonntag, der 15. Mai 1947. Wir wanderten durch das schöne, vom Kriege unzerstörte Hannoversch-Münden. Die mittelalterliche Stadt lag noch verschlafen unter einem klaren, blauen Himmel. Uns berührte der unaussprechliche Zauber des echten, noch nicht entfremdeten Deutschlands. Wir gingen zur Weser hinunter bis zu dem Stein mit dem berühmten Spruch. Wir lasen gemeinsam: *Wo Werra und Fulda sich küssen Wir setzten uns auf die Bank, die dort unter einem Kastanienbaum stand. Ich sagte: Ich liebe Dich, ich liebe Dich, [272] Elisabeth. Willst Du meine Frau werden? Sie sagte: "Ich liebe Dich auch. Ja, ich will Deine Frau werden." Als in diesem Augenblick die Glocken von Hannoversch-Münden anfingen zu läuten, überkam mich ein Gefühl der transzendenten Geborgenheit. Leider habe ich nicht die Gabe, es zu beschreiben. Wenn ich es nachträglich versuchen würde, entstünde wahrscheinlich eine sentimentale Geschichte. Deshalb lasse ich es lieber. Außenstehende können es ohnehin nicht nachempfinden. Wir saßen eine Stunde oder auch zwei auf dieser Bank und waren offen für das Glück des Augenblicks, für Sonne, Frieden, für das Plätschern der Weserwellen, die sonntäglichen Spaziergänger, für die Angler und für eine heile Welt. Wir hatten das Bedürfnis, uns einen ruhigen Platz an der Fulda zu suchen. Wir liefen Hand in Hand stromaufwärts am Ufer entlang, bis wir eine Stelle fanden, die von den Häusern nicht eingesehen werden konnte. Wie übermütige Kinder warfen wir unsere Kleider in das Gebüsch. Ich badete, Elisabeth sonnte sich, ihr war das Wasser zu kalt. Damals kannte ich einen Wesenszug an ihr noch nicht. Sie verstummte immer mehr. Ist nicht alles sehr schön? Sie antwortete wortkarg: "Ja, es ist alles schön." Bist Du nicht glücklich?" - "Ja, sehr." Mehr konnte ich aus ihr nicht herausbekommen. Erzähle doch, was Dich bedrückt. Sage es, spucke es aus, wenn es Dich quält. Es war, als ob ich an eine halb verheilte Wunde rührte. "Ja, Dir kann ich alles erzählen, meiner Schwester Rosemarie auch, sonst aber niemandem. Es war so schrecklich. Meine Eltern hatten mich aus Bromberg nach Breslau geschickt. Dort sollte ich Geographie studieren. Ich wußte im Grunde nicht, welche Vorlesungen ich belegen wollte. Mein Vater sagte, ich solle mich ein Jahr lang an der Universität umsehen und umhören, um mich dann für ein Fach zu entscheiden. Das tat ich auch als gehorsame Tochter und ging treu und brav zu den Vorlesungen, die mich überhaupt nicht interes[273]sierten. Damals wohnte ich bei Großväterchen und Großmütterchen Heidelk, den Eltern von Mutti, Vaters zweiter Frau. Ich bin aber nur ein Semester lang zu den Vorlesungen gegangen, dann hatte Goebbels in Berlin seine berühmte Rede gehalten und die Zuhörer gefragt, ob sie den totalen Krieg wollten. Das Volk hatte ja geschrien, und ich wurde zum Kriegsdienst verpflichtet. Ich kam zum Fernmeldeamt in Breslau in die Vermittlung. Da habe ich gestöpselt. So wußte ich immer, wo im Reich Fliegerangriffe waren. Dort wurden als Folge der Bombenabwürfe die Telefonleitungen tagelang lahmgelegt. Das war in Berlin sehr häufig der Fall. Nach sechs Wochen wurde ich von der Post, da dort genügend kriegsverpflichtetes Personal vorhanden war, zur Kriminalpolizei versetzt. Meine Vorgesetzten waren ausnahmslos SS-Leute.Bei der Mordkommission, bei der ich eingesetzt wurde, hatte ich einen sehr netten Chef. Er hieß Kommissar Noth und gehörte nicht der Gestapo an. Die Kriminalpolizei wollte von dieser Organisation nicht viel wissen. Zwischen den beiden Sparten des Polizeiapparates gab es heftige Kompetenzstreitigkeiten. Bei der Mordkommission mußte ich Schreibarbeiten durchführen. Man setzte mich in ein Zimmer zu Papa Wurche, wie wir ihn nannten. Der hatte eine Glatze. Dort hatte ich Berichte zu schreiben. Dann wurden wir Studentinnen den einzelnen Kommissaren zugeteilt, die nachts Streife durch Breslau gingen oder Leichen identifizierten und Mordfälle aufzuklären hatten. Wir bekamen den Auftrag, aus abgelegenen Straßen, öffentlichen Bedürfnisanstalten und Gaststätten Homosexuelle herauszuholen. Sie wurden unter Hitler strafrechtlich verfolgt. Wir bekamen bald einen Blick für diese Leute. Wenn wir einen gefaßt hatten, nahmen wir seine Personalien auf. Er wurde später dann verhaftet. Das waren ausschließlich Angehörige der oberen Schichten: Akademiker, Rechtsanwälte, Ärzte, Schauspieler. Später bekam ich den Auftrag, aus den Akten der Kripo die persönlichen Daten aus den Gerichtsprotokollen und dem Krankheitsverlauf von Mördern herauszuziehen, die geistig [274] nicht gesund waren und die wegen ihrer Tat nicht zum Tode verurteilt worden sind. Die Nazis wollten ein Gesetz herausbringen, daß Menschen, die wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit ein milderes Urteil bekommen hatten, getötet werden konnten. Da war ich auch einmal in einer Irrenanstalt und sollte für einzelne Fälle die ärztlichen Befunde auswerten. Ich war mit dieser Arbeit nicht sehr weit gekommen, denn insgesamt dauerte mein Einsatz bei der Kripo in Breslau nur von September 1944 bis zum Januar 1945.Nach Weihnachten begann schon die Bevölkerung zu fliehen. Wir Mädchen wurden belehrt, daß wir unter Kriegsrecht ständen und bei unerlaubter Entfernung von unserer Dienststelle man uns verfolgen und standrechtlich erschießen würde. Einige Studentinnen hatten sich trotzdem in den Westen abgesetzt. Ich blieb bei Großväterchen, der beim Volkssturm war. Großmütterchen hatten wir nach Nordhausen zu Onkel Karl Bohl geschickt, der dort eine Arztpraxis hatte. Breslau lag dann bald unter Artilleriebeschuß. Auch zwei Bombenangriffe habe ich in Breslau erlebt. Wir wurden zur Identifizierung der Toten eingesetzt. Als sich die Lage immer mehr zuspitzte, ging Großväterchen zu Kommissar Noth und bat ihn, mich rechtzeitig aus Breslau hinauszuschicken. Der tat das auch und versetzte mich im Januar zur Außenstelle der Kriminalpolizei Breslau nach Hirschberg. Dort sollte ich mich mit seiner Frau in Verbindung setzen, die er bereits aus Breslau weggeschickt hatte. Ich wollte das nicht, da mein Vater mir gesagt hatte, im Notfall würde sich die Familie bei Onkel Karl in Nordhausen treffen. Kommissar Noth brachte mich zum Hauptbahnhof und setzte mich in den Zug nach Hirschberg. Dort blieb ich vierzehn Tage und wohnte bei Freunden von Großväterchen. Auf meiner Dienststelle hatte ich wieder jemanden gefunden, der sich um mich kümmerte. Ein junger Kriminalbeamter, dessen Namen ich leider vergessen habe, sagte mir eines Tages, es würde nicht mehr lange dauern, dann wäre die Rote Armee in Hirschberg. Die anderen dienstverpflichteten Mädchen, [275] die in Breslau geblieben waren, wurden viel zu spät und dann zu Fuß in südlicher Richtung in Marsch gesetzt. Später erfuhr ich, daß sie von den Tschechen umgebracht worden sind. Nur ein oder zwei sind lebend herausgekommen. Der junge, sehr hilfsbereite Kommissar hatte mir eine Fahrkarte nach Nordhausen und Entlassungspapiere von der Kriminalpolizei besorgt. Ich bin also ganz offiziell entlassen worden.Eines Nachts fuhr ich dann in Richtung Görlitz ab. Die Fahrt war fürchterlich. Der Zug war überfüllt, die Klos verdreckt. Wenn man einmal mußte, ging das nur, wenn der Zug hielt. Den Leuten wurde schlecht, einige kotzten in der Gegend herum. Gehungert habe ich nicht. Auf den großen Bahnhöfen waren Stationen des Roten Kreuzes, wo es warmen Tee, Brot und Soldatenverpflegung gab. Von Görlitz wollte ich über Dresden nach Nordhausen fahren. Der Zug hielt plötzlich zwischen dem Vorort Klotzsche und Dresden Hauptbahnhof. Hier war Gleis an Gleis, und es standen viele Züge nebeneinander. Es war der 13. Februar abends. Alle Leute sollten wegen des Fliegeralarms aus dem Zug aussteigen. Dann sah ich, wie die ersten Angriffswellen die Christbäume setzten. Dann rannte die unübersehbare Menschenmenge aus dem Zug heraus und wollte sich, ich weiß nicht mehr wo, in Sicherheit bringen. Ich blieb ganz alleine in meinem Abteil sitzen und dachte, wenn es mich treffen soll, dann trifft es mich sowieso. Nur der Gedanke war entsetzlich, daß meine Familie nicht erfahren würde, wo und wie ich ums Leben gekommen sei. Dann war der erste Angriff vorbei. Ich lebte noch, und die Leute kamen wieder in den Zug zurück. Wir dachten alle, nun geht es weiter, aber wir standen und standen. Dann hörte ich erneut die Alarmsirenen und bald darauf dieses eintönige Dröhnen der anfliegenden angloamerikanischen Bombergeschwader. Jetzt wurden nur Brandbomben und Phosphor abgeworfen. Dresden brannte, der Himmel war von Rauch geschwärzt. Es hieß, der Dresdner Hauptbahnhof sei total zerstört, unser Zug müsse rückwärtig aus der brennenden Stadt herausfahren. [276] Das tat er dann auch und machte eine riesige Schleife zurück nach Görlitz über Leipzig. Dort war wieder Fliegeralarm. Wir stiegen alle aus und liefen in den Bahnhofsbunker. Da kam ich mir wie in einer Mausefalle vor.Der Zug fuhr nach dem Fliegerangriff dann doch weiter. Ich hatte, wie gesagt, das Ziel, so schnell wie möglich zu Onkel Karl Bohl zu kommen. Irgendwo, es war aber schon nicht mehr weit bis Nordhausen, blieb der Zug plötzlich stehen. Es hieß, die Strecke werde ständig von britischen Tieffliegern angegriffen. Es wäre Selbstmord weiterzufahren. Ich stieg aus und rief bei Onkel Karl an. Großmütterchen, die, wie ich wohl schon erzählt habe, eine Schwester von Onkel Karl ist, war schon da. Auf meine Frage, ob mich jemand mit dem Auto abholen könne, bekam ich zur Antwort, ich solle geduldig warten, denn es sei nicht genügend Benzin vorhanden. Irgendwann fuhr dann der Zug weiter, und ich kam im Morgengrauen in Nordhausen an. Es war der 15. Februar 1945. Großmütterchen machte mir die Tür von Onkel Karls Wohnung auf, begrüßte mich überschwenglich herzlich und packte mich erst einmal ins Bett. Ich schlief lange tief und erfrischend. Als ich aufwachte, standen meine Eltern, meine Brüder Klaus und Friedel und meine Schwester Karin an meinem Bett. Sie waren gerade aus Greifswald angekommen, wo sie vorübergehend bei meiner Großmutter Grünewald gewohnt hatten. In Nordhausen erlebte ich dann zwei Fliegerangriffe im Abstand von nur vier Stunden. Das war viel schlimmer als in Dresden, denn Onkel Karls Haus lag im Zentrum der Bombenteppiche. Nordhausen war eine alte schöne Fachwerkstadt. Die angloamerikanisehen Bombergeschwader griffen sie nach einer ausgeklügelten Taktik an. Die erste Welle warf Sprengbomben, mit denen die Häuser aufgerissen wurden. Die zweite Welle schüttete Phosphor in das Inferno. Dadurch wurde alles in Brand gesetzt: Menschen, Holz, Tapeten, Gardinen und was sonst noch an brennbarem Material vorhanden ist. Das war schrecklich. Entschuldige, Du kannst keine Frauentränen sehen. Ich weiß [277] es und will mich beherrschen.Die Angriffe auf Nordhausen fanden erst im April statt. Die Stadt sollte zerstört werden, damit die Amerikaner sie leichter einnehmen konnten. Wir saßen während der Bombenangriffe in Onkel Karls Weinlager, das noch eine Etage unter dem eigentlichen Keller war. Mein Vater und Onkel Karl hatten vorher einen zweiten Ausgang in den Garten gegraben. Der tunnelartige Gang endete in einem Unterstand mitten im Garten. In ihn hatten wir vorsorglich eine große Eichentruhe gestellt, die wir randvoll mit Lebensmitteln gepackt hatten. In den Garten fielen zwei Bomben. Wenn wir uns in dem Unterstand aufgehalten hätten, wären wir alle tot gewesen, denn der Garten war durch die zwei Bomben völlig umgewühlt worden. Der Unterstand mit der wertvollen Truhe war verschwunden. An seiner Stelle sahen wir einen riesigen Bombentrichter. Erst später fanden wir die Truhe an einem ganz anderen Platz. Sie war offensichtlich durch die Gewalt der Explosion acht oder zehn Meter unter der Erde weiter gepreßt worden. Wir haben sie dann ausgegraben. Die Lebensmittel, Konservendosen, Brote, Nährmittel waren unversehrt. Unser Haus war äußerlich bis auf die Fensterscheiben heil geblieben. Innen drin waren teilweise die Türen aus den Angeln gerissen. Eine Tür lag quer auf dem Eßzimmertisch. In der oberen Etage waren Onkel Karls medizinische Geräte, beispielsweise der Röntgenapparat, unbeschädigt. Am nächsten Tag hatten wir furchtbare Angst vor einem neuen Bombenangriff. Um ihm zu entgehen, flohen wir aufs Land. Wir bepackten einen Handwagen mit Lebensmitteln und marschierten in zwei oder drei Stunden bis zu einem Bauernhof, dessen Besitzer ein Patient von Onkel Karl war. Der Hof hieß Himmelreich. Als wir ankamen, war er schon mit Flüchtlingen und Ausgebombten vollgestopft. Der Bauer wies uns einen Platz im Schafstall an. Das Gebäude war auch schon überbelegt, aber wir konnten uns ein Strohlager bereiten und waren glücklich, außerhalb der Gefahrenzone zu sein. Nachts liefen uns Ratten und Mäuse über die Gesichter. Du kennst mei [278]ne Aversion gegen alles, was so schnell huscht. Aber was soll's?Die Verpflegung war gut, gekocht wurde in großen Kesseln für alle gemeinsam. Die Bäuerin oder das Rote Kreuz, ich weiß es nicht mehr genau, hatten alles gut organisiert. Das Wetter war herrlich. Wir saßen draußen auf dem Hof oder gingen spazieren. Auf einem der Ausflüge, ich hatte Karin und Friedel mitgenommen, wurden wir von britischen Tieffliegern beschossen. Wir warfen uns in den Straßengraben und blieben in der Deckung unverletzt. Bei Nordhausen war in einem Berg eine Munitionsfabrik. Der Ort hieß Niedersachswerfen. In dem Werk arbeiteten die Insassen eines Konzentrationslagers. Nach den Bombenangriffen waren viele Häftlinge entflohen. Um nicht entdeckt zu werden, hatten sie sich in Erdlöchern, in Büschen und allen möglichen Schlupflöchern versteckt. Bei unseren Spaziergängen konnten wir die geschwächten, grauen Gestalten sehen, denn das frisch begrünte Gebüsch bot ihnen nur wenig Schutz. Die Wachmannschaft, die das Gebiet mit Hunden durchkämmte, hatte nicht viel Mühe, sie aufzustöbern und in das Lager zurückzubringen. Wir wurden unfreiwillig Zeuge eines Vorgangs, den ich nie vergessen werde. Alle Geflüchteten, die wieder aufgegriffen worden waren, mußten eine große Grube ausgraben, sich an deren Rand stellen und wurden dann, einer nach dem anderen, erschossen. Die toten Körper fielen in das Massengrab, das mindestens zwanzig Meter lang war. Das spielte sich alles in der Umgebung des Bauernhofes Himmelreich ab - wie sinnig. Mein Vater hatte den Massenmord an den Häftlingen beobachtet und uns verboten, weiterhin in der Umgebung spazieren zu gehen. Ich habe nur die Schüsse gehört, mit denen die Häftlinge getötet wurden. Wir konnten von einer Bergkuppe aus, die die herrliche Frühlingslandschaft krönte, beobachten, daß in Nordhausen noch einmal einige Bomben fielen. Wahrscheinlich hatten die Flugzeuge ihre Last nicht in den banachbarten Großstädten abwerfen können und sie deswegen in Nordhausen abgeladen. Über unsere Köpfe hinweg schoß amerikanische Artillerie nach [279] Nordhausen hinein. Kurz danach hörten wir, daß die Stadt von amerikanischen Truppen besetzt und für drei Tage zum Plündern frei gegeben worden sei.Mein Vater und Onkel Karl faßten den Entschluß, in unser Haus zurückzugehen, in der Hoffnung, dort noch zu retten, was gerettet werden kann. Wir packten unsere sieben Sachen auf einen Handwagen und zogen als geschlagener Trupp, immerhin waren wir acht Personen, nach Nordhausen zurück. Als wir ankamen, war das Haus geplündert. Das Bild, das sich uns bot, entsprach dem, was man immer so hört. Die Betten waren aufgeschlitzt, die Einmachgläser hinein gekippt. In den Praxisräumen hatten die Leute sich hingesetzt und ihre Notdurft verrichtet. Einer hatte sich den Hintern mit dem Kopfkissenbezug abgewischt. Geplündert wurde nicht von den amerikanischen Soldaten und von den KZ-Häftlingen, die viel zu schwach dazu waren, sondern von den Kriegsgefangenen, von polnischen, russischen und tschechischen Zwangsarbeitern. Ich weiß nicht mehr, wer sich dort alles herumgetrieben hatte. Als wir wieder zu Hause waren, wurde die Praxis zur Sanitätsstation erklärt und unter den Schutz des amerikanischen Militärs gestellt. Wir haben zwar in den Nächten Wache geschoben, aber es belästigte uns niemand mehr. Onkel Karl hatte früher schon Kriegsgefangene ärztlich betreut, so daß wir von Stund an, als wir wieder zu Hause waren, unbehelligt blieben. Die amerikanischen Soldaten haben allerdings systematisch alle Häuser und Gärten nach Wertsachen und technischen Geräten durchsucht. So haben sie eines Tages meinem Vater die goldene Uhr vom Arm abgenommen. Hier habe ich zum ersten Mal in meinem Leben schwarze Soldaten gesehen. In ihrem Verhalten gab es aber keine Unterschiede zu den weißen Amerikanern. Wenn sie betrunken waren, wurden sie besonders agressiv. In den Kellern lagerten noch große Alkoholbestände, denn Nordhausen hatte viele Schnapsbrennereien. Die amerikanischen Soldaten führten systematische Raubzüge nach ihnen durch. Sie waren unter Alkoholeinfluß unberechenbar und auch unvor [280]sichtig.In der Nähe unseres Hauses hatten sie einmal einen solchen Keller, in dem Schnaps lagerte, gefunden, dort gesoffen und geraucht. Auf einmal stand die Brennerei in Flammen, und einer der Soldaten kam brennend herausgelaufen. Es dauerte nicht lange, da rückte ein Trupp amerikanischer Militärpolizei an. Wir mußten uns in einer Reihe aufstellen. Sie sagten, wir hätten die Brennerei angezündet und beinahe den Tod eines amerikanischen Soldaten verschuldet. Ein völlig betrunkener Militärpolizist fuchtelte mit einer Maschinenpistole vor uns herum und sagte, er würde uns alle erschießen. Da kam dessen Vorgesetzter, hatte ihn zurück gepfiffen und sich bei uns entschuldigt. So war der ganze Spuk schnell ausgestanden. In Nordhausen brannte es in diesen Tagen dauernd irgendwo. Wir hatten ständig Angst, unser Haus könnte durch Funkenflug entzündet werden. Deswegen haben wir nachts immer Feuerwache geschoben. Um neunzehn Uhr war Sperrstunde, und niemand durfte auf die Straße gehen. Es war also unmöglich, bei ausbrechenden Bränden die Feuerwehr zu alarmieren. Ein solches Haus brannte dann eben völlig nieder. Als eines Nachts auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Gebäude in Flammen stand, hatte mein Bruder Klaus gerade Feuerwachdienst. Er löschte die herüberfliegenden Funken vom Dachboden aus. Es war eine warme Maiennacht, denn mein Vater, Onkel Karl und ich saßen im Garten. Ich hörte, wie die Männer über unsere verzweifelte Lage sprachen und berieten, was zu tun sei. Onkel Karl meinte, unser Leben sei unter diesen Umständen sinnlos, er habe genügend Gift für uns alle. Mein Vater entgegnete, er trage die Verantwortung für seine Familie und Selbstmord läge für ihn völlig außerhalb des Denkbaren. Selbst in einer solch verzweifelten Lage, aus der er auch keinen Ausweg sehe, könne er sein Gewissen nicht mit einem Selbstmord belasten. Ich habe dieses Gespräch mitbekommen. Mutti schlief im Haus mit ihren beiden kleinen Kindern, und Klaus war auf dem Dach und wehrte, wie gesagt, die herüberschlagenden Flammen ab. [281] Am 8. Mai fingen die Amerikaner plötzlich an, wie die Verrückten in die Luft zu schießen. Als wir uns erkundigten, was das zu bedeuten habe, sagte man uns, es sei deren Siegesfeier. Wir atmeten auf. Der Krieg war endlich zu Ende. Wir sollten aber noch nicht zur Ruhe kommen, denn wir hörten Gerüchte, die besagten, daß die Siegermächte die Jaltalinie beschlossen hatten. Uns war zunächst nicht bekannt, wo sie verlief. Was wir Deutschen niemals für möglich gehalten hätten, wurde von Tag zu Tag größere Gewißheit. Die amerikanischen und die sowjetischen Politiker hatten sich zur Teilung der deutschen und europäischen Kriegsbeute verbrüdert. Wir fragten uns, von welchen Kräften in Europa und in den Vereinigten Staaten diese Politik betrieben wurde. In Europa von der kommunistischen Linken. Das war eindeutig. Sie konnte damit einen großen Teil Mitteleuropas unter ihren Einfluß bringen. Aber wer zum Teufel war es in den freiheitlichen Vereinigten Staaten? Welche Politiker können dort ein Interesse an der Expansion des menschenverachtenden Sowjetsystems soweit nach Westen haben? Ist die amerikanische Demokratie auch schon von der revolutionären Linken unterwandert? Für diese Fragen fanden wir damals keine Antwort. Erst viel später erfuhren wir, daß die Beschlüsse in Jalta gefaßt worden sind. Für uns stand es jedenfalls eines Tages fest, die Amerikaner würden Thüringen und damit Nordhausen räumen und diesen Landstrich den Russen überlassen. Als mein Vater dies erfuhr, faßte er sofort den Entschluß, seine vier Kinder und seine junge Frau vor den Ausschreitungen der Roten Armee in Sicherheit zu bringen. Die amerikanischen Soldaten hatten uns junge Frauen und Mädchen auch belästigt, aber vergewaltigt wurde jedenfalls in Nordhausen niemand. Die Soldaten kamen abends oft zu uns in den Garten und fragten uns Frauen, ob wir mit ihnen schlafen wollten. Wir sind dann ins Haus gelaufen. Sie haben uns aber niemals verfolgt. Ob die amerikanische Armee eine bessere sexuelle Truppenbetreuung hatte als die Russen, weiß ich nicht. Mir ist aber bekannt, daß viele amerikanische Soldaten ge[282]schlechtskrank waren, denn sie kamen mit ihren Leiden in die Praxis meines Onkels.Mein Vater kannte einen Herrn Bierschenk, der an der Weender Landstraße in Göttingen wohnte. Er hatte dort ein Haus und ein Auslieferungslager von Siemens. Da mein Vater seit vielen Jahren Niederlassungen dieser Firma im Osten geleitet hatte, bestanden alte Geschäftsbeziehungen zu eben diesem Herrn Bierschenk. Vielleicht stammen sie noch aus der Zeit, als wir vor dem Kriege zeitweise in Nordhausen wohnten, wohin mein Vater von Siemens versetzt worden war. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Wir beratschlagten, wie wir uns am besten nach Göttingen absetzen könnten. Ich hatte noch zwei Schulfreundinnen in Nordhausen, mit denen ich Kontakt aufnahm. Die Eltern einer gewissen Ilse Westphal hatten dort eine Getreidehandlung. Sie wären bereit, sagte mir meine Freundin, einen Lastwagen zur Verfügung zu stellen. Treibstoff müßte ich besorgen, denn im Tank sei kein Tropfen Benzin. Ich nahm Verbindung zu einer zweiten Schulfreundin auf, die Bärbel Spengemann hieß. Ihre Eltern hatten einen Treibstoffhandel, ein ähnliches Unternehmen wie Dein Bruder Hans-Joachim in Thorn. Die Familie Spengemann stand in Verbindung zu dem Domänenpächter Graf in Schloß Marienburg bei Hildesheim. Von Bärbel Spengemann bekam ich Benzin. Onkel Karl gab uns Möbel, Betten, einen Schrank, Tisch und einige Stühle. Eines Tages wurde der Lastwagen mit unserer Habe beladen, und die ganze Familie kletterte hinauf. Unser Problem war nur noch der nicht vorhandene Passierschein. Es war verboten, ohne ein solches Papier die Stadt zu verlassen. Bärbel Spengemann kam mit uns mit, denn sie kannte alle möglichen Schleichwege nach Hildesheim. Wir mußten versuchen, amerikanische Streifen zu umgehen, da wir auf alle Fälle vermeiden wollten, aufgegriffen und wieder zurück geschickt zu werden. Wir fuhren am Harz entlang über das Eichsfeld und kamen mit der Unterstützung der wegkundigen Bärbel unbehelligt in Göttingen an. Das war also geschafft - ha puh. [283] Uns fiel ein Stein vom Herzen, als uns Herr Bierschenk freundlich empfing und in eine seiner Garagen einziehen ließ. Du kennst diese Behausung aus eigener Anschauung. Sie war nicht sehr komfortabel. Wir waren aber froh, ein Dach über dem Kopf zu haben.Herr Bierschenk hatte in einem Nebenraum einen Herd aufgestellt. Dort konnten wir uns selbst unser Essen kochen. Als wir uns kennenlernten, damals in dem Verbindungshaus bei der Adventsfeier, wohnten wir schon im Kreuzbergring Nr. 1, in den unteren Räumen eines Einfamilienhauses. Mein Vater, der jetzt wieder eine Niederlassung von Siemens in Göttingen leitet, war in den kritischen Situationen wie ein Fels in der Brandung. Ihn konnte nichts erschüttern, je höher die Wellen schlugen, umso ruhiger wurde er. Es tut gut, sich alles von der Seele zu reden. Immer, wenn meine Gefühle aufgewühlt sind, holen mich die Schatten der Vergangenheit ein. Schlimmer als die Flucht war der frühe Tod meiner Mutter. Ich bin manchmal sehr traurig. Vor Dir brauche ich es nicht zu verbergen. Aber dies 'Du bist zum Tanzen geboren', glaubst Du das immer noch? Was hatte ich bisher von meiner Jugend? Darüber denke einmal nach." Ich überlege es mir, sagte ich. Elisabeth konnte schweigen. Nur vor ihrer Schwester Rosemarie hatte sie keine Geheimnisse. Nachdem sie ihr von unserer heimlichen Verlobung berichtet hatte, bekamen wir eine Einladung nach Kassel, wo Rosemarie mit ihrem Mann Joachim Bunge lebte. Sie hatte eine geräumige Wohnung in einem Krankenhaus, in dem ihr Mann als Arzt tätig war. Zwischen den beiden Schwestern bestand ein inniges Vertrauensverhältnis. Rosemarie hatte nach dem Tode ihrer Mutter sich der kleineren Schwester gegenüber verantwortlich gefühlt und wollte ihr, so gut sie konnte, die Mutter ersetzen. Sie war die offenere und litt nicht so wie die sensible und verschlossene kleine Schwester unter dem strengen Vater. Er hatte, da seine drei Kinder wieder eine Mutter haben sollten, bald eine noch sehr junge und hübsche Frau geheiratet. Sie war nicht sehr viel älter als Rosemarie und Elisabeth. [284] Da sie sehr schnell zwei eigene Kinder bekamen, war Elisabeths Stiefmutter in ihrer Aufgabe überfordert. Diese Umstände führten dazu, daß Elisabeth sich stärker zu ihrer Schwester hingezogen fühlte als zu ihrer Familie in Göttingen, bei der sie wohnte. Zwischen den beiden Schwestern gab es keine Geheimnisse. So erfuhr Rosemarie von unserer heimlichen Verlobung eher als Vater und Mutti.Es dauerte keine drei Wochen, bis Elisabeth und ich nach Kassel eingeladen wurden. Wir fuhren mit dem Zug hin. Für mich war dieser Besuch peinlich, da mich das Ehepaar Bunge, das schon wieder in geordneten bürgerlichen Verhältnissen lebte, kritisch musterte. Natürlich nicht plump und anzüglich, aber doch mit der unausgesprochenen Frage, ob ich denn auch wohl der richtige Mann für Elisabeth sei. Ich war in meinem grauen Anzug, in meinem Luftwaffenmantel bei aller Liebe keine Erscheinung, die Rosemarie sich als Schwager vorstellen konnte. "Wann bist Du mit Deinem Studium fertig? Wie sind die Berufsaussichten?" Diese und ähnliche Fragen stürmten auf mich ein. Ich hatte sie erwartet, gab ausweichende, vorher schon zurechtgelegte Antworten. Da ich Elisabeth über alles in der Welt liebte und genau wußte, welchen Einfluß ihre Schwester auf sie hatte, gab ich mich selbstsicherer und hoffnungsvoller, als ich wirklich war. Was mich am meisten beeindruckte, war das Essen. Während man allgemein mit dem, was es auf die Verpflegungsmarken zu kaufen gab, auszukommen hatte, bekam Rosemarie von der Krankenhausküche alles geliefert, was sie bestellte. So läßt sich leben, dachte ich und aß mich so satt, wie schon lange nicht mehr. Es war eine andere Welt, in der sich zurecht zu finden mir schwer fiel. Sie habe fest damit gerechnet, daß wir erst morgen nach Göttingen zurückfahren würden, meinte Rosemarie ganz unbefangen. Sie habe sich über unseren Besuch gefreut. Alle halbherzigen Einwendungen unsererseits wies sie in ihrer bestimmten Art zurück. Da gab es keine Widerrede. Wir würden also, dachte ich, unsere erste Nacht gemeinsam verbringen. [285] Für Rosemarie ist das selbstverständlich und für Elisabeth anscheinend auch. Warum hast Du Skrupel? Du willst Dich Deinem geliebten Mädchen nicht in dieser Weise nähern, bevor Du nicht eine gesicherte gemeinsame Zukunft bieten kannst, dachte ich. Ist es nicht Deine Pflicht, Dich in Deinen stürmischen Gefühlen zurückzuhalten?Als Rosemarie uns in unsere getrennten Zimmer brachte und uns ermahnte, keinen Unsinn zu machen, verflüchtigten sich diese Gedanken, als hätte es sie niemals gegeben. Und ich war zum ersten Mal mit meinem geliebten Mädchen zusammen. Wir versanken ineinander und waren zum ersten Mal eins. Am nächsten Nachmittag fuhren wir mit der Eisenbahn nach Göttingen zurück. Wir saßen uns auf den Fensterplätzen gegenüber. Elisabeth blätterte in einer Modezeitschrift. Sie ist, dachte ich, in ihrer Grazie, rätselvollen Anmut und still leuchtenden Schönheit nicht zu übertreffen. Die großen braunen Augen faszinierten mich durch Seelenfülle. Nun bleib mal auf dem Teppich, alter Junge, dachte ich. Sie war es doch, die Dich nach Kassel geschleift und die für Deine ungesicherte Lage kaum Verständnis hat. Von Mitgefühl wollen wir gar nicht sprechen. Dann dieses 'Gute Nacht' und die moralischen Ermahnungen ihrer Schwester, als sie uns in den Zimmern allein ließ. Warum hast Du solche Gedanken? Du bist dabei, Elisabeth mit Dreck zu bewerfen. Du stellst sie auf eine Stufe mit der Luftwaffenfreundin, die Dich neulich in Deiner Studentenbude besucht hatte und über Nacht bei Dir geblieben war. Du mochtest dieses Strandgut Deines liederlichen Luftwaffendaseins nicht wegschicken. Das hat Elisabeth nicht verdient. Du hast sie doch, als sie von ihren Kriegserlebnissen und von der Flucht erzählte, in den Ehrentempel der Frauen Deiner Familie aufgenommen. Warum beschmutzt Du sie jetzt? Viel menschliches Elend, Hoffnungslosigkeit, seelische Trümmerfelder, Verzweiflung hat dieser Krieg hinterlassen. Woher schöpfst Du, woher Elisabeth die Hoffnung, [286] es würde sich alles zum Guten wenden? Ich bat sie, die Zeitschrift wegzulegen, und erzählte ihr, daß ich eine Predigt von Bischof Hanns Lilje über die Theodizee gehört habe, die mich sehr beeindruckt hat.Was das sei, die Theodizee, wollte Elisabeth wissen. Ich sagte, es sei der Titel des Hauptwerkes von Gottfried Wilhelm von Leibniz, in dem der Philosoph lehrte, daß die bestehende Welt die beste aller möglichen Welten sei. Die unendlich vielen seelischen Kraftzentren würden nicht von sich aus aufeinander einwirken, sondern seien von Gott durch Harmonie verbunden. Lilje hatte in der Predigt den aktuellen Bezug zu unserer Lage hergestellt, indem er sagte, Gott habe uns ein widriges Schicksal auferlegt, um uns zu prüfen. Die religiös gegründete Theodizee, wie sie Lilje verstehe, habe in mir die Hoffnung geweckt, daß es Gott gut mit uns meine, er uns liebe, wir eine Zukunft hätten, wir als Deutsche nicht verdammt seien, trotz allem Bösen, das wir erlebt haben und das in unserem Namen getan worden sei. Die Hoffnung, versuchte ich mit meinen Worten zu erklären, die man aus der Theodizee schöpfen könne, sei unüberwindlicher und elementarer als diejenige, die die säkularisierte Ideologie des Marxismus vermittle. Der Mensch lebe, denke und handle immer in die Zukunft hinein. Er verwirkliche sich, indem er, was er sich vorstelle, handelnd durchführe. Die entscheidende Kraft, die ihn darin beflügele, sei die Hoffnung. Von den Atheisten werde behauptet, das Christentum habe die Menschen nicht verändert. Sie würden weiter Kriege führen und sich gegenseitig vernichten. Der Bischof habe in seiner Predigt diesem Argument ein Bild entgegen gehalten. Das Christentum sei mit Seife zu vergleichen. Es spreche nicht gegen das Reinigungsmittel, wenn Menschen ablehnen, es zu benutzen und lieber schmutzig bleiben. Mich habe die Predigt von Bischof Lilje sehr beeindruckt. Die Kirche sei voll gewesen bis auf den letzten Platz. Er komme demnächst wieder nach Göttingen. Ich fragte Elisabeth, ob sie dann nicht mit mir mitkommen wolle. [287] "Entschuldige", sagte Elisabeth, "was hast Du eben gesagt?" Etwas betroffen fügte sie hinzu, sie habe gerade an etwas anderes gedacht. Woran denn, wollte ich wissen. Das würde sie nicht sagen, auf keinen Fall, das käme überhaupt nicht in Frage. Es halfen keine Bitten und keine Drohungen, sie sagte es nicht. Erst kurz vor Göttingen meinte sie mit einer unübertrefflichen Unschuldsmiene: "Weißt Du, ich habe von meinen Eltern vor ein paar Tagen ein Kleid bekommen, das meiner Mutter gehörte und in dem sie immer sehr schön aussah. Ich hatte mir, als Du von Lilje sprachst, ausgemalt, wie ich es verändern werde." Elisabeth blätterte hastig in der Modezeitschrift, hielt sie mir vor die Nase und tippte mit dem Finger auf ein Hochzeitskleid. "Sieh mal", sagte sie leichthin, "ist das nicht schön? So ein Kleid möchte ich auch einmal haben. Ich könnte es selbst nähen." Sie erklärte mir, was ihre Meisterin dazu sagen und wieviel Spaß ihr das machen würde. Ich verstand nichts davon, es interessierte mich auch nicht, und ich konnte es mir nicht vorstellen, wie sie in dem Kleid aussehen würde. Sie hätte auch einen Fetzen anziehen können, ich hätte sie hinreißend gefunden.In den folgenden Wochen trafen wir uns wieder fast täglich. Elisabeth wollte, daß wir uns zu Pfingsten siebenundvierzig im Kreis der Familie Grünewald verloben. Im Kreuzbergring Nr.1 sollten klare Verhältnisse herrschen. Geduld war nicht ihre Stärke. Mir war es ein ernstes Anliegen, unsere Verlobung erst dann offiziell bekanntzugeben, wenn ich die Diplomprüfung bestanden habe, die auf Oktober festgesetzt war. Elisabeth konnte ihre Ziele sehr hartnäckig verfolgen. Meine Bedingung für die Verlobung war, daß sie nur mit Vater, Mutti und den drei Kindern als ein intimes, kleines Fest gefeiert wird. Dazu gehören Blumen. Woher sollte ich einen Strauß für Mutti, die auf solche Aufmerksamkeiten größten Wert legte, und woher einen zweiten Strauß für Elisabeth bekommen? Die Blumengeschäfte waren noch leer. Ich stand am ersten Pfingstfeiertag früher als notwendig auf, [288] ging zum Nikolausberger Weg, an dem der Botanische Garten liegt. Ich kannte ihn gut, denn ich hatte mich mit Peter Schilke dort oft für das Diplomexamen vorbereitet und mir in der Gräserabteilung die verschiedenen Grassorten eingeprägt. Seit dem Frühjahr hatte ich mich hier oft mit Elisabeth getroffen. Mir war dadurch der Wachstumsstand der einzelnen Pflanzen sehr gut bekannt, auch daß zu Pfingsten die Schwertlilien in voller Blüte standen.Da der Botanische Garten an Sonn- und Feiertagen geschlossen war, kletterte ich über die hohe Mauer, die ihn zum Nikolausberger Weg abgrenzt, und pflückte zwei große Liliensträuße. Auf demselben, ebenso verbotenen wie beschwerlichen Weg ging ich zum Nikolausberger Weg zurück und von hier über die Weender Landstraße zum Kreuzbergring. Die beiden Sträuße lösten große Freude aus. Zum Glück wurde ich nicht gefragt, wo ich die frischen Blumen besorgt hatte. Dank des Organisationstalentes von Vater Grünewald gab es ein für meine damaligen Begriffe opulentes Mittagessen. In einer kurzen Tischrede charakterisierte er mich als den jungen Weltverbesserer. Auch der Nachmittag und Abend verliefen harmonisch, was im Hause Grünewald nicht selbstverständlich war. Ich hatte dort schon Abende erlebt, an denen es aus mir nicht verständlichen Gründen vor Spannungen knisterte. Bisher hatte mir Elisabeth von dieser Seite ihres Familienlebens außer einzelnen vagen Andeutungen nichts erzählt. Sie konnte schweigen, manchmal so beharrlich, daß ich mich von ihrer Verschlossenheit verletzt fühlte. Ich wollte und konnte nicht verstehen, daß jede Familie ihre Geheimnisse hat und Verschwiegenheit eine Tugend ist. Stille Wasser sind tief, dachte ich und machte mich daran, mit allerlei psychologischem Schnickschnack die verborgenen Schichten ihres Charakters kennenzulernen. Ich wollte in ihr wie in einem aufgeschlagenen Buch lesen. Es war einige Tage oder Wochen nach der Währungsreform, als wir beide wieder einmal über die Weender bummelten. Schon einige Monate vor dem Diplomexamen hatte ich damit begon [289]nen, mich intensiv mit Psychologie zu beschäftigen, jedoch ohne Vorlesungen und Seminare in diesem Fach zu besuchen. Das Thema meiner Diplomarbeit war: "Die Psychologie der bäuerlichen Betriebsberatung". Was mich vordringlich an der Psychologie interessierte, war der bäuerliche Mensch, den ich mit ihrer Hilfe damals erkennen und durchschauen wollte. Dabei wurde mir bewußt, daß er in seinem Verhalten von den sozialen Beziehungen beeinflußt wird, in denen er aufwächst und lebt. In dieser Erkenntnis wurde ich durch das Studium vieler Autoren, besonders aber durch die Schriften von Wilhelm Heinrich Riehl(15), bestärkt, durch die ich die Begriffe "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" zu unterscheiden gelernt hatte. Er überzeugte mich auch davon, daß Wissenschaft und Technik ein Unglück für das deutsche Volk mit sich brächten, weil sie die Entfremdung der Menschen nach sich zögen, die jetzt auf einem Meer von Relativismus und Materialismus steuerlos treiben würden. Riehl verherrlichte die bäuerliche Lebensform und sah in ihr ein Bollwerk der Natur gegen eine vom autonomen Menschen gemachte Gesellschaft, die zerfahren, seelisch verflacht und entwurzelt der Vermassung anheim gefallen sei. Die gleichen Ideen vertraten auch mein Hochschullehrer Prof. Dr. Wilhelm Seedorf und Heinrich Sohnrey, die in der Landflucht und Verstädterung ein Symptom des nationalen Unglücks sahen.Nach dem Diplomexamen studierte ich Agrarpolitik und Volkswirtschaft. Dabei ließ ich mich von dem Ziel leiten, das ich nie aus dem Auge verloren hatte: die soziale Gerechtigkeit. Die kapitalistische Industriegesellschaft hatte es versäumt, die Arbeiter und die Bauern zu integrieren. Diese breiten Schichten des deutschen Volkes, zu denen nach dem Zweiten Weltkrieg die Flüchtlinge, Ausgebombten und Vertriebenen hinzukamen, seien nur durch mehr soziale Gerechtigkeit und Solidarität in die Gesellschaft einzugliedern. Zugegeben: Ich glaubte damals, die Welt sei 'aus einem Punkte zu kurieren', und übersah, daß es Mephisto ist, der dem Schüler in Faust diese Weisheit nahelegt. Jedenfalls sprach [290] ich über die Notwendigkeit von mehr sozialer Gerechtigkeit und den Inhalt meiner Diplomarbeit, als wir beide unseren Spaziergang auf der Weender machten. Als ich dann anfing, über die unsoziale Währungsreform zu schimpfen, die den Flüchtling mit 40,- DM abspeiste, während der Eigentümer riesiger Sachwerte ungeschoren geblieben war, ging Elisabeth spontan von mir weg und sah sich die Brautkleider an, die in einem Schaufenster ausgestellt waren. Ich hatte das im ersten Augenblick nicht bemerkt und war, immer noch auf die Westlichen Alliierten schimpfend, weiter gegangen, die den großen Fabrikbesitzern und Großlandwirten ihre Vermögen belassen hatten, während den Flüchtlingen die letzten Ersparnisse zehn zu eins abgewertet worden sind. Als ich mich nach Elisabeth umsah, stand sie immer noch vor dem Schaufenster, das mich nicht im geringsten interessierte. Mir schoß in diesem Augenblick der Gedanke durch den Kopf, es sei unmöglich, mit einer Frau ein Gespräch zu führen, die sich für modischen Firlefanz mehr interessiere als für meine geistigen Engagements. Das sei nicht mehr Launenhaftigkeit, sondern bewußte Herausforderung. Unser Spaziergang durch die Altstadt, in der die Schaufenster vor Ware überquollen, war für mich kein Vergnügen mehr. Wir sprachen nur mehrere unverbindliche Sätze miteinander und verabschiedeten uns kühl, ohne ein neues Treffen zu vereinbaren. Am nächsten Tag ging ich zum Institut für Psychologische Medizin, schilderte dort zwei jungen Ärzten das exzentrische und manchmal auch depressive Verhalten meiner Freundin und bat sie, mich zu beraten, wie ich mich ihr gegenüber verhalten solle.Sie fragten mich nach Einzelheiten der von mir geschilderten Szenen und ob ich den Eindruck hätte, meine Freundin sei bewußt kapriziös. Das konnte ich nicht bestätigen. Aus meiner Schilderung könnten sie nur entnehmen, daß man eine solche Frau nicht heirate, meinten die Ärzte, nachdem sie sich kurz miteinander beraten hatten. Einer von ihnen fügte dann mit süffisantem Lächeln hinzu, so veranlagte junge Damen seien gute Geliebte. Ich solle das Fräulein Grünewald [291] doch einmal zu ihnen ins Institut schicken, dann würden sie eine Psychoanalyse und, wenn nötig, auch eine Therapie durchführen.Ich verschwieg Elisabeth meinen Besuch bei den Psychologen. Sie zu diesen Ärzten zu schicken, war meiner Ansicht nach ein völlig abwegiger Rat. Ich liebte Elisabeth. Was ich suchte, war eine Partnerin, mit der ich Gespräche führen konnte, die auf meine Gedanken eingehen und bei der ich Zuneigung und Glück finden werde. Eine Geliebte hätte ich in der ehemaligen Luftwaffenhelferin haben können, die mich gerne häufiger besucht hätte. Sie beherrschte dererlei Spiele hervorragend. Was ich suchte, waren menschliche Werte, war Liebe. Sie kann, so war damals meine Meinung, psychisch heilsamer sein bei Elisabeth und bei mir als alle wissenschaftlichen Analysen und Therapien. Ich nahm mir, auch das war eine Auswirkung des Beratungsgespräches bei den beiden Ärzten, vor, Elisabeth so zu lieben, wie sie ist, auch mit ihren Fehlern und den sie belastenden Erinnerungen. Eines Tages gingen wir wieder einmal auf dem Wall spazieren und sprachen über grundsätzliche Fragen der Heirat und der Ehe. Unser Weg führte uns am Botanischen Garten, am Deutschen Theater vorbei bis zum Auditorium Maximum, dann rechts herum in Richtung Weende. Links blieben Bierschenks Garagen liegen, wo Elisabeth nach der Flucht aus Nordhausen zunächst gewohnt hatte. Kurz dahinter bogen wir auf einen alten, parkähnlichen Friedhof ein. Wir setzten uns auf eine Grabplatte und unterhielten uns an diesem ungewöhnlichen Ort über die kirchliche Trauung. Ich will versuchen, aus der Erinnerung heraus die Gedanken wiederzugeben, die wir damals austauschten. Wir vertraten beide die Ansicht, daß wir zunächst die Eheschließung beim Standesamt und danach in der Kirche vollziehen, also die bäuerlich-bürgerliche Form wahren wollten. In dieser Beziehung gab es keine Meinungsunterschiede, denn wir beide gehörten evangelischen Familien an und sahen keinen Anlaß, aus der Tradition unserer Vorfahren auszusteigen. [292] Dann sagte Elisabeth: "In der evangelischen Kirche muß ich das Gelöbnis ablegen, Dich zu lieben, zu ehren und Dir treu zu sein, bis der Tod uns scheidet. Dem Sinne nach ist das die Trauungsformel. Man kann es sich vornehmen, aber geloben vor dem Angesicht Gottes kann ich es nicht. In dreißig, vierzig oder gar fünfzig Jahren, ich hoffe, wir leben noch solange, kann unendlich viel geschehen. Ich finde es anmaßend und überheblich, ein solches Versprechen abzugeben. Man sollte sagen, ich will mir Mühe geben, diesen hohen Anspruch zu erfüllen."Auf meinen Einwand, eine Ehe sei nicht eine Verbindung auf Zeit, sondern für das ganze Leben, entgegnete Elisabeth: "In der katholischen Kirche ist die Ehe ein Sakrament. In unserer evangelisch-lutherischen Kirche ist sie es nicht. Luther wird sich schon etwas dabei gedacht haben, wenn er die Sakramente auf die Taufe und das Abendmahl beschränkt. Nach dem Augsburger Glaubensbekenntnis ist die Ehe ein freiwilliger Akt und auflösbar. Unsere Kirche ist den jungen Leuten gegenüber toleranter als die katholische. Ich verstehe es nicht, warum diese Formel ein unerläßlicher Bestandteil der kirchlichen Trauung sein muß. Für mich wird sie ohne jeden Einfluß auf mein Verhalten sein. Mir sagt sie nichts." Ob sie einmal Kinder haben wolle, fragte ich sie und fügte hinzu, ob sie nicht auch der Meinung sei, daß eine Ehe um der Kindererziehung willen auf Dauer angelegt sein müsse. Wenn sie nur ein Versprechen für eine Ehe auf Zeit geben wolle, so würden dadurch grundsätzliche Voraussetzungen, die ich an die Gründung einer Familie knüpfe, in Frage gestellt. "Das hat damit nichts zu tun", entgegnete Elisabeth und fügte zur Begründung ihrer Ansicht hinzu: "In dem Gelöbnis 'bis der Tod Euch scheidet' liegt eine Anmaßung des Menschen. Er glaubt, er kann sein Leben autonom in der Hand halten. Das ist nicht christlich gedacht. Der Mensch kann nicht in allen Lebenslagen und Gefühlsregungen über sich selbst bestimmen." [293] Beeinträchtigt diese Ansicht nicht die soziale Institution und Lebensform der Ehe und der Familie?"Ja, ich will ebenso wie Du Kinder bekommen, die Mutterrolle übernehmen. Eine Ehe einzugehen, bedeutet auch für mich die Gründung einer Familie, aber ich weiß nicht, ob ich Liebe und Treue in ihrer ganzen Breite und Vielfalt über den Alltag und alle Wechselfälle des Lebens hinweg retten kann. Was ist, wenn Du gegen das Gebot von immerwährender Liebe und Treue verstößt? Bin ich dann weiter an mein Gelöbnis gebunden? Es geht mir dabei nicht nur um die körperliche Treue, die ist wohl noch am leichtesten zu bewahren. Ich bin mir der Schwere und der Tragweite dieses Gelöbnisses voll bewußt. Du hast ein starkes Interesse, nein sogar das Bedürfnis, mich ganz fest an Dich zu binden. Ich will aber Kontakte zu anderen Menschen pflegen. Mein Vater, meine Schwester Rosemarie und meine Freunde bedeuten mir viel, und ich will meine Beziehungen zu ihnen nicht aufgeben. Das sind Bindungen unterschiedlicher Qualität. Man sollte nicht wegen der Ehe die persönliche Freiheit aufgeben. Du brauchst extrem viel Liebe und Zuneigung. Ich will aber deswegen nicht alle anderen Bindungen einschlafen lassen, sondern auch anderen Menschen einen Teil meiner Zuneigung schenken. Da wir uns lieben, ist es nicht schwer, uns festzuhalten. Wir müssen aber lernen, uns auch gewähren zu lassen. Ich sehe den Sinn einer Ehe auch darin, dem Partner zu einer möglichst großen Freiheit zu verhelfen. Man darf nicht in den Fehler verfallen, die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten des Ehepartners einzuschränken. Man sollte ihm helfen, zum Mann oder zur Frau heranzureifen." Was Elisabeth mir weiter sagte, klang nicht romantisch oder lyrisch, eher nüchtern, sachlich, rational. Das war für mich neu und enthüllte etwas von dem rätselvollen Charakter des Mädchens mit den samtenen, braunen Augen, die ich mit diesen nüchternen Äußerungen nicht in Einklang zu bringen vermochte. Die Freiheit wovon, dachte ich, hat für sie einen genauso verführerischen Reiz wie für Dich. Die Freiheit wofür, müs [294]sen wir beide erst lernen. Es wird Dir schon gelingen, unsere beiden Freiheiten in einer Partnerschaft sinnvoll und schöpferisch zu verbinden. Du darfst sie jetzt nicht weiter provozieren, indem Du die Bedeutung der göttlichen Gnade für das Gedeihen unserer Ehe ansprichst. Nur eins wollte ich noch wissen: ob ihr an dem Segen ihrer Eltern für unsere Verbindung gelegen sei."Nicht Segen, daran liegt mir nicht viel. Wenn meine Eltern mit dem Mann meiner Wahl nicht einverstanden wären, würde ich ihn trotzdem heiraten. Ich würde mich über ihre Entscheidung hinwegsetzen", meinte sie eigensinnig und fügte mit Nachdruck hinzu: "Mein Vater hatte Rosemarie und mir, als wir in das heiratsfähige Alter kamen, einmal gesagt, er würde unserer Wahl zustimmen, wenn es anständige Männer sind. Daran erkennst Du die vorurteilslose, liberale Einstellung meines Vaters. Im übrigen haben meine Eltern meiner Entscheidung für Dich zugestimmt. Wenn Du es unbedingt so willst, kann ich auch sagen: Den Segen meines Vaters für unsere Ehe haben wir. Bist Du jetzt zufrieden? Es liegt mir nicht, viel zu versprechen und wenig zu halten. Ich verspreche lieber wenig und halte viel." Mit solch einer Frau kannst Du eine Familie gründen, dachte ich. |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|