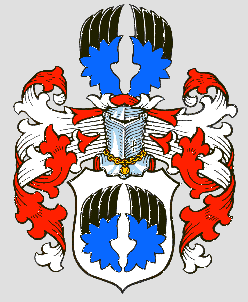
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Jugendjahre sorglos und frei |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
Mein Bruder Hans-Joachim hatte in der geringen Freizeit, die ihm die Technikerschule in Bielitz ließ, ein Paddelboot gebaut. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt, in den Semesterferien von der Weichselquelle, die in der Nähe von [103] Bielitz liegt, bis zur Mündung in seinem eigenen zweisitzigen Kajak zu fahren. Nach mehreren Tagen kam er wohlbehalten in Altthorn an. Hier erholte er sich, faßte Verpflegung und setzte die Fahrt mit mir zusammen fort. Unser Ziel war Danzig. Das war für mich ein großes Erlebnis. Die Weichsel war damals, und ist es wohl heute noch, ein wilder Strom mit vielen gefährlichen Strudeln. Mein Bruder hatte sie auf seiner Fahrt von ihrer Quelle an gründlich kennengelernt. Ich hatte ein grenzenloses Vertrauen zu dem von ihm gebauten Kajak, zu seinem Können, auch mit gefährlichen Situationen fertig zu werden. Manchmal neigte sich das Boot bei starken Windböen tief zur Seite, und die Wellen schlugen gefährlich über den Bootsrand. Einmal wollten wir auf einer Sandbank eine Rast einlegen. Der Sand dieser sicher erscheinenden Insel war aber in ständiger Bewegung. Er wurde an der stromaufwärts liegenden Seite durch die Strömung abgetragen und stromabwärts wieder angelandet. Mein Bruder steuerte die Sandbank an und fuhr seitlich so dicht heran, daß er sich vom Boot aus am Sand festhalten konnte. Ich stieg aus, fand aber keinen festen Boden unter den Füßen, sondern versank langsam in dem an dieser Stelle noch schwimmenden, nicht fest abgelagerten Sand. Ich war schon bis zur Gürtellinie eingesackt, bis mein Bruder mit großer Mühe herangepaddelt war und mich am Hemdkragen in das Boot hineinhob. Ich hatte wieder einmal einen Schutzengel, diesmal in Gestalt meines Bruders. Dieses unsichtbare Wesen hatte mir schon zur Seite gestanden, als ich mir mit dem Tesching bei einer Fuchsjagd in den Rücken geschossen hatte. Die Kugel war unterhalb des Schulterblattes eingedrungen, zwischen Brustkorb und Lunge zwanzig oder fünfundzwanzig Zentimeter von der Einschußstelle dicht neben der Wirbelsäule stecken geblieben. "Das war ein Meisterschuß", sagte der Arzt, als er sie herausoperiert hatte. "Die Kugel hat weder die Lunge noch das Rückgrat verletzt. In vierzehn Tagen ist wieder alles in Ordnung." Für das schwierige Landemanöver an der Sandbank wurden wir [104] durch einen herrlichen Ausblick auf das Steilufer der Weichsel entschädigt. Es gibt Landschaften an der unteren Weichsel, deren Zauber sich mir unvergeßlich eingeprägt hat. An einer solchen Stelle haben wir gerastet. Unser Blick kletterte das bewaldete Steilufer hinauf und wurde von dem die Bergkuppe krönenden Schloß Sartowitz angezogen. Ich war schon einmal anläßlich eines Schulausfluges dort oben. Mein Klassenkamerad Joachim Schlegel hatte uns eingeladen. Sein Vater war dort Administrator der Güter des Grafen Schwerin v. Schwanenfeld. Wir hatten den sechsundneunzig Morgen großen Park durchstreift, waren zur Teufelskanzel gegangen und hatten von dort aus den schönsten Blick genossen, den es in ganz Westpreußen gibt. Man sieht von dort aus zu Füßen die Weichsel mit ihren Sandbänken und Buhnen sich durch die Kempen winden. Auf dem gegenüberliegenden Ufer liegen die friedlichen Dörfer, saftigen Wiesen und sorgfältig bestellten Äcker der Kulmer Niederung. Wir konnten uns nicht sattsehen an dem Steilufer und dem gelben, in der Sonne liegenden Schloß mit der Terrasse, die die gesamte der Weichsel zugewandte, etwa fünfundzwanzig Meter lange Seite einnahm. An diesem Abend haben wir zum zweiten Mal in einer Kempe nicht weit vom Weichselufer entfernt übernachtet. Ein Zelt hatten wir nicht. Wir rollten uns in die Decken ein und beobachteten, wie die Holzscheite in unserem Lagerfeuer langsam niederbrannten. Dazu sangen unzählige Sprosser ihre melancholischen, schluchzenden Lieder. Das Feuer glimmte noch, als wir in einen tiefen, erfrischenden Schlaf versunken waren. Morgens erwachten wir bei Sonnenaufgang. Ich mußte zum nächsten Dorf gehen, um Milch und Eier einzukaufen. Es war nicht weit von unserem Lagerplatz entfernt. "Na, Jungchen, wo kommst Du denn so früh am Morgen her?", empfing mich eine Bäuerin, die gerade aus dem Kuhstall herauskam. Sie strich sich die vom Melken noch feuchten Hände an der Schürze ab. Ich berichtete ihr, woher wir gekommen sind und daß Danzig das Ziel unserer Paddeltour sei. Dann sagte ich ihr meine Wünsche. "Ja, ja, kannst Du alles be[105]kommen. An der Weichsel habt Ihr übernachtet? Warum seid Ihr nicht zu uns auf den Hof gekommen? Ein Strohlager in der Scheune hätten wir Euch gerne gegeben. Wieviel Milch und wieviel Eier brauchst Du denn?" Als ich bezahlen wollte, sagte sie: "Na, steck man Dein Geld wieder ein. Es wäre schlimm, wenn wir dies bißchen Milch und die paar Eierchen nicht übrig hätten. Gute Fahrt und grüß mir Danzig. Wenn wir dies Tor zur Welt nicht hätten, wären wir arm dran. Was soll ich Dir sagen, Du weißt ja, Jungchen." Mein Bruder war hocherfreut über die noch kuhwarme Milch und die Eier. Er hatte schon Kaffeewasser aufgesetzt. Als es kochte, nahm er den Topf vom Feuer und brühte den Kaffee. Ich schlug sechs Eier in die Bratpfanne. Sie waren eine gute Grundlage für die vor uns liegenden Strapazen. Bis Danzig waren es noch zwei ereignisreiche Tage. Wir ließen uns willig vom Entdeckungsfieber anstecken, kamen uns wie Flußindianer vor, die ausgezogen waren, eine Welt voll Einsamkeit, Gefahren und Ursprünglichkeit zu erobern. Die Weichsel ist noch ganz wilde Natur. Ihr ehemals preußischer Unterlauf von Thorn bis Danzig war eingedeicht und das Flußbett reguliert. Im früher russisch-polnischen Oberlauf, den mein Bruder auf seiner Fahrt kennengelernt hatte, waren fast keine wasserbaulichen Maßnahmen durchgeführt worden. Deswegen waren die Überschwemmungen in dem Teil der Weichsel, den wir jetzt entdeckten, für die von deutschen Bauern und Gutshöfen besiedelten Niederungen eine ständig drohende Gefahr. Wenn ich an die Tage dieser Fahrt zurückdenke, fühle ich Sonne und Licht auf meinem tiefbraun eingebrannten Oberkörper, sehe ich meine Heimat an mir vorüber gleiten, Kempen, saftige Wiesen mit schwarzbunten Kühen, die erstaunt zu grasen aufhörten, wenn sie uns im Paddelboot vorbei gleiten sahen, die Marienburg, überwältigend der Kunstwille ihrer Baumeister und ihre Wehrhaftigkeit gegen die mächtig anstürmenden Slawen. Die Nächte unter dem weiten, sternklaren Himmel sind mir unvergeßlich. Das letzte Mal, bevor wir nach Danzig kamen, übernachteten wir auf dem Gebiet der Freistadt Danzig in [106] einem gemütlichen Gasthaus. "Woher kommt Ihr?" fragte der Gastwirt ungläubig. "Aus Thorn, genauer gesagt, aus Altthorn." Man schaute uns in der Gaststube an, als ob wir von einem anderen Stern kämen. Dabei verband uns ein gemeinsames Schicksal. Das wurde den hier versammelten Fischern und Bauern bewußt. Sie sprachen mit uns, als ob wir von einem sehr gefahrvollen Vorposten in ihren sicheren Unterstand zurückgekehrt waren. So gut wie dort sind wir in unserem ganzen Leben nicht betreut worden. Gaststätten sind in Westpreußen nicht sehr komfortabel gewesen. In ihnen schaltete und waltete aber stets eine Seele von Mensch. Das war die Wirtin. Sie bereitete uns ein deftiges Abendessen mit kräftigem, selbstgebackenem Roggenbrot, Unmengen Butter und hausgemachter Wurst. Unter dem hoch über mir aufgetürmten Federbett habe ich geschlafen wie ein Bär. Am nächsten Tag waren wir am Ziel. Möwen begrüßten uns schon weit vor dem Danziger Hafen. Sie saßen auf den Kaimauern aufgereiht. Kreischend breitete eine von ihnen ihre Flügel, flog ganz dicht neben uns her und beäugte unsere kleine Nußschale, die sich zwischen den riesigen Schiffen, Kuttern und Lastkähnen des Hafens bis zum Krantor hindurchwand. Ganz in der Nähe war das Bootshaus des Danziger Rudervereins. Werner, unser älterer Bruder, war damals dessen aktives Mitglied. Schon in Bromberg hatte er an mehreren Rennen im Achter des Rudervereins "Fridjof" teilgenommen. Während seiner kaufmännischen Ausbildung in Danzig hatte er das Training für den von ihm sehr geschätzten Rennsport fortgesetzt. Es war wohl das erste Mal in meinem Leben, daß ich nach dieser abenteuerlichen Fahrt von meinem erwachsenen Bruder und dessen gestandenen Ruderkameraden als vollwertiger Wassersportler angesehen wurde. Ich fühlte mich jedenfalls schon sehr erwachsen. Umso größer war der Dämpfer, den ich einige Tage später in Danzig erhielt. Wir drei Brüder wollten gemeinsam ins Kino gehen und uns den Film "Amphitrion" ansehen. An der Kinokasse fragte die Kassiererin, wie alt ich sei. Ich legte ein Jahr hinzu und sag[107]te vierzehn. Jugendlichen sei der Zutritt verboten. Ich ging wie ein begossener Pudel in die Wohnung meines Bruders zurück. Werner und Hans-Joachim amüsierten sich köstlich bei den ehelichen Fehltritten von Zeus und den Eifersüchteleien von Adele Sandrock, die die Hera spielte und die ihren Göttergatten auf Schritt und Tritt beobachtete. Ich kann an diesem Film aus heutiger Sicht nichts entdecken, was die Sittlichkeit meiner Jugend hätte gefährden können. Vielleicht haben die damaligen Vertreter der bürgerlichen Moral daran Anstoß genommen, daß Hera, die Göttin der Ehe, mit ihrem eigenen Bruder verheiratet war und dieser Hüter des Rechts seiner Gemahlin nun wirklich handfeste Anlässe zur Eifersucht gegeben hat. In den Erinnerungen an sorglose Jugendjahre nehmen meine Großeltern einen bedeutenden Platz ein. Sie lebten mit ihren Kindern und Enkeln unter einem Dach zusammen. Ernsthafte Spannungen zwischen den Generationen gab es nicht. Oma und Opa hatten in unserer Großfamilie ihren festen Platz. Die Häuser der Bauern und der selbständigen Handwerker in der Niederung waren groß genug für ein menschenwürdiges Zusammenleben. Meine Großeltern wurden in Haus und Hof überall gebraucht. Ich kann mir meine Jugend in meinem Elternhaus ohne Opa und Oma gar nicht vorstellen. Seit dem Tode ihres Mannes lebte meine Großmutter Hermine wieder in ihrem Elternhaus, das sich durch den Umbau sehr verändert hatte. In ihrer Jugend hatte sie mit ihren Eltern nur plattdeutsch gesprochen. Wie sie oft erzählte, konnte sie bei ihrer Einschulung dem Lehrer in Gurske, der sie hochdeutsch anredete, nur auf platt antworten. Da hätte sie sich so geschämt, daß sie sich schwor, ihre Kinder in der hochdeutschen Sprache unterrichten zu lassen. Geschichten aus ihrer Jugend zu erzählen, war ihre ganze Leidenschaft. Den größten Eindruck hatte auf sie die Weichselüberschwemmung im Winter 1870/71 gemacht. Da war sie achtzehn Jahre alt. Für Oma war die nahe Weichsel eine ständige Bedrohung. Deswegen hatte sie sich mit ihren Erzählungen vom Weichselhochwasser auch wohl nur die Angst von der Seele geredet. Wenn [108] ein Gast in unser Haus kam, erzählte sie ihm ihre Überschwemmungsgeschichte, ob er es hören wollte oder nicht. Sie schilderte dann sehr wortreich und anschaulich, wie nach dem Dammbruch das Vieh des Hofes auf den Mühlenberg in Rossgarten getrieben wurde, wie die Männer Heu, Stroh und Futterrüben dorthin brachten, sie ständig dort blieben und in der Windmühle ein Strohlager geschüttet hatten. Als wir Kinder diese Geschichte das erste Mal hörten, war das unheimlich interessant. Uns lief ein Schauer nach dem anderen über den Rücken. Unsere Großmutter erzählte, wie unsere Familie mit dem Gesinde auf dem Dachboden des Wohnhauses gelebt, gekocht und vor Angst, das Wasser könnte noch weiter steigen, kaum geschlafen und einer von ihnen ständig Wache gehalten hätte. Eines Tages sei die Temperatur so stark gesunken, daß die riesige Wasserfläche, die die gesamte Niederung überflutet hatte, zugefroren gewesen sei. Nun seien sie von der Außenwelt abgeschnitten gewesen und konnten nicht einmal mit. dem Boot zum Vieh hinfahren. Da der Frost immer stärker geworden sei, hätte die Eisfläche, ohne Gefahr, einzubrechen, betreten werden können. Großmutters Erzählung gipfelte dann in dem bis ins einzelne Detail ausgeschmückten Bericht, wie ihr Vater das erste Mal das Steindach des Hauses öffnete und alle in Höhe der siebten Dachpfanne auf das Eis hinausgestiegen seien. Die Eiswüste habe bis zum Horizont gereicht. Man habe an manchen Stellen die Baumkronen, die Dächer der Gehöfte und den Kirchturm gesehen. Es sei eine gespenstische, weiße Landschaft gewesen. Nur an den aus der eintönigen Fläche herausragenden Dächern habe man sich orientieren können. Erst nach vierzehn Tagen oder gar drei Wochen, so ganz genau konnte sich Oma nicht mehr erinnern, sei es wärmer geworden und das Eis geschmolzen. Es sei mit riesigem Getöse gebrochen, was sich wie Kanonenschüsse angehört habe. Die gewaltigen Eisschollen hätten sich stromabwärts in Bewegung gesetzt: "Und ich sage Euch", fuhr Oma fort, "wir haben unser Haus, ja vielleicht sogar unser Leben, den drei großen [109] Birnbäumen zu verdanken, die die Eisschollen mit ihren starken Kronen vom Haus ablenkten. Zwei der Bäume sind dabei so beschädigt worden, daß sie später gerodet werden mußten. Einer von ihnen steht heute noch im Garten. Er ist schon ganz hohl und altersschwach. Opa stellt immer seine Gartengeräte in den Stamm. Ich habe ihm schon oft gesagt, er soll das sein lassen. Aber so, als ob er mich damit ärgern will, tut er es immer wieder." Meine Großmutter erzählte diese Geschichte so häufig, daß wir Geschwister sie auswendig konnten. Einer von uns schlich sich manchmal leise zur Wohnzimmertür oder zur Veranda, wo Oma mit ihrem Erzählopfer saß. Wenn der Kundschafter zurückkam, wurde er von den anderen Geschwistern gefragt: "Wie weit ist denn Oma mit ihrer Geschichte?" "Ach, sie ist erst bei der siebten Dachpfanne. Jetzt dauert es noch eine halbe Stunde, bis sie fertig ist", war die Antwort. Wieder hatten wir einen Grund zum Lachen. Trotzdem sind wir durch die westpreußischen Geschichten unserer Oma Hermine unbewußt in unseren Heimatboden verwurzelt worden. Durch ihre unerschöpfliche Liebe und durch ihr bescheidenes Wesen, das uns stets als Vorbild vor Augen stand, sind wir Enkelkinder geprägt worden. Es war nicht ihr Niveau, es waren ihre Herzensbildung und ihre Seelenstärke, die wir erst später als Erwachsene erkannt haben. Wir fragten uns oft, wodurch sie diese Charakterzüge erworben hatte. Es muß wohl ihre schwere und leidvolle Jugend gewesen sein, die sie so geprägt hatte. Nach dem grauenvollen Hochwasser war ihr Vater August Zittlau seelisch zusammengebrochen. Ein Jahr davor war seine Frau gestorben. Er fing daraufhin an zu trinken. Seine Spielleidenschaft erwähnte ich schon. Er war kaum in der Lage, bei der Beseitigung der Schlammassen zu helfen, die das abfließende Hochwasser in den Ställen und im Erdgeschoß des Wohnhauses zurückgelassen hatte. Sein Hof interessierte ihn kaum noch. Die Gastwirtschaft in Gurske rückte immer mehr in den Mittelpunkt seines Lebens. Unsere Oma hatte dadurch seit ihrem achtzehnten Lebensjahr die Verantwortung für die Erziehung [110] ihrer Geschwister. Trotz dieses schweren Schicksals, vielleicht gerade deswegen, nahm sie es uns fünf Enkeln nicht übel, wenn wir uns über ihre Marotten lustig machten. Eine davon war ihre Rolle, die sie allzu gerne spielte, ich möchte sie "bescheidene und anspruchslose Großmutter" nennen. Einmal ist sie dabei hereingefallen. Sie hatte versucht, sich nichts anmerken zu lassen, daß wir ihr hinter die Schliche gekommen waren. Sie hatte eine Schwäche für gutes und reichliches Essen, wollte sie aber vor uns unbedingt verbergen. Wenn ihr beim Mittagessen von meiner Mutter ein zweites Stück Fleisch angeboten wurde, antwortete sie mit einer zimperlichen Stimme, sie sei schon satt. Wir wußten, daß es nicht stimmt und daß sie nur weiter genötigt sein wollte. Wir Geschwister sahen uns grinsend an, wenn Oma sich überreden ließ und einen weiteren Teller voll mit Genuß verspeiste. Wenn Enten geschlachtet worden waren, was in jedem Jahr zu meiner Mutters Geburtstag geschah, dann aß Oma demonstrativ nur die minderwertigen Teile. "Gebt mir das Hinterviertelchen, dann bin ich schon zufrieden", sagte sie mit einer Stimme, die ihre maßlose Bescheidenheit ausdrücken sollte. Eines Tages, es war vor Weihnachten, wurde außer zwei Schweinen ein Rind geschlachtet. Der Hausschlachter Japs, der auch Kirchendiener war und Sonntag für Sonntag in der Gursker Kirche mit wehenden Rockschößen zur Tür der Kanzel lief, um sie dem Herrn Pfarrer beflissen zu öffnen, hatte die Schweine verarbeitet und von dem besagten Rind die beiden Hinterkeulen in der Waschküche an den Haken gehängt. Die ganze Familie war zu Marohns, unseren Lieblingsnachbarn, eingeladen. Es war schon spät abends, als wir wieder nach Hause kamen. Wir hatten noch Appetit auf eine Kleinigkeit, auf eine Wurstbrühe, ein mit frischer Wurst belegtes Brot oder so etwas ähnliches. Meine Mutter fragte auch die Oma nach ihrem Wunsch. Sie dachte wohl in diesem Augenblick nicht daran, daß ein Rind und nicht Enten geschlachtet worden waren. Mit dem uns schon bekannten Tremolo in der Stimme, die einer Schauspielerin zum Ruhm gereicht hätte, sagte sie: "Gebt mir nur ein Hinterviertel[111]chen, dann bin ich schon zufrieden." Dieser Ausspruch wurde zum geflügelten Wort der Familie. Er wurde in übertragenem Sinne immer dann benutzt, wenn jemand von uns maßlose Ansprüche stellte, sie aber unter dem Mäntelchen der Bescheidenheit verbergen wollte. Der Sinn für Maß und Mitte war in unserer Familie tief verankert. Dazu hatte Oma beigetragen. Sie war ein westpreußisches Original. Ihre Einmaligkeit war aus ihrer tiefen Verwurzelung im Mythos ihrer Heimat erwachsen. Nach unserem heutigen Verständnis war ihr Horizont allzu begrenzt. Jetzt fuhr sie höchstens nach Thorn, um einzukaufen, oder nach Krossen, wo ihre Tochter Anna Linde mit ihrem Mann auf einem großen Hof lebte. Diesen Lebenskreis, der jetzt in Polen lag, hatte sie niemals verlassen. Wo sie war, bekam alles seine Ordnung. Sie verfügte nur über geringe finanzielle Mittel, die sie von meinem Vater monatlich erhielt. Trotzdem verbrauchte sie davon für sich persönlich kaum etwas, sondern gab es ihren beiden Töchtern. Wenn ich mir jetzt, indem ich diese Zeilen niederschreibe, überlege, warum sich in Omas Umgebung das Leben ordnete, so komme ich zu einem recht einfachen Ergebnis. Es war ihr ausgleichendes, stets hilfsbereites Wesen. Sie wußte instinktiv, wann in Altthorn und wann in Gurske oder in Krossen etwas nicht im Lot war. Dann war sie zur Stelle und half unaufdringlich, wo sie konnte. Bis Berlin, wo ihr jüngster Sohn Gerhard lebte, reichte ihr segensreicher Einfluß nicht. Mit zunehmendem Alter wurde sie immer schrulliger, und wir hatten häufig Grund, uns darüber lustig zu machen. Ich war der Jüngste und deswegen in den Augen meiner Geschwister der Verzug meiner Mutter. Alles, was meine Brüder und Schwestern in dieser Hinsicht an Gerüchten in die Welt setzten, war stark übertrieben. Nicht bestreiten konnte ich, wenn sie das Verhalten meiner Mutter mir gegenüber bespöttelten. Sie hatte manchmal in Aufwallung einer sonst untypischen Zärtlichkeit meine Hand in die ihre gelegt und dazu gesagt: "Händchen wie ein Blumenblättchen." Diese Geste demonstrierten meine Schwestern allzu gerne und legten [112] in ihre Stimme ein Übermaß mütterlicher Liebe. Das ärgerte mich. Da habe ich mich nicht anders gegen solch einen Spott wehren können als durch Handgreiflichkeiten. Ein Faustschlag hatte meine Schwester Ursula einmal so schwer in den Unterleib getroffen, daß sie wegen plötzlich aufgetretener großer Schmerzen sofort in das Krankenhaus eingeliefert werden mußte. Der Blinddarm hatte sich entzündet. Durch meinen Faustschlag war er geplatzt. Die Operation war nicht ganz einfach, denn Eiter war bereits in die Bauchhöhle gelangt. Ursula wurde aber bald wieder gesund, kam nach Hause, und unsere Scharmützel begannen von neuem. Mir ging es damals sehr gut, denn ich war nur von guten Menschen umgeben und wuchs in einer Atmosphäre auf, die von Liebe erfüllt war. Wenn mein Vater hörte, daß meine Mutter wieder einmal "Händchen wie ein Blumenblättchen" sagte, meinte er, aus mir könne kein rechter Bauer werden. Ich empfand das ganz anders und habe mich zuweilen an ihm wegen seiner mir unbillig erschienenen Härte gerächt. In dieser Zeit erschien an jedem Monatsanfang ein Mann auf unserem Hof, der die Beiträge für die Krankenkasse abholte. Sie wurden immer bar von meinem Vater bezahlt. Der Kassierer bekam noch einen Schnaps und fuhr auf seinem Fahrrad zum nächsten Hof weiter. An einem 1. April 1935 oder 1936 wollte ich mich bei meinem Vater für seine mir zu hart erscheinenden Erziehungsmethoden revanchieren. Er war gerade auf dem Getreidespeicher damit beschäftigt, die Futterration für unsere dreizehn Pferde und die zweiunddreißig Milchkühe abzuwiegen. Ich rief von unten auf den im oberen Stockwerk liegenden Futterboden herauf: "Papa, der Kassierer von der Krankenhasse ist da. Komme doch schnell, er sitzt im Wohnzimmer." Mein Vater klopfte den Kraftfutterstaub vom Anzug, kam die Treppe herunter und ging mit schnellen Schritten quer über den Hof. Ich war in sicherem Abstand vorausgelaufen. Als ich an der Haustür angekommen war, rief ich meinem Vater zu: "April, April, der Kassierer ist noch gar nicht da." Dies war für meinen autoritären Vater eine ungeheure Heraus[113]forderung. Das wußte ich genau. Ich durfte mir niemals die Freiheit herausnehmen, einen unserer Leute bei der Arbeit zu stören. Nun habe ich gegen diese Richtlinie bei meinem Vater selber verstoßen. Mir lief es heiß und kalt über den Rücken. Was würde er tun? Würde er mit Erziehungsmaßnahmen oder mit Humor reagieren? Beides war zu erwarten, beides tat er aber nicht. Mein Vater, dem ich ohne mit der Wimper zu zucken in die Augen sah, war so überrascht von meinem "April, April", daß er, der stets Geistesgegenwärtige, sagte: "Mein Junge, das darf aber nicht noch einmal geschehen." Mir tat in diesem Augenblick mein Verhalten leid. Ich hatte meinen Vater auf die Probe gestellt. Er hatte sie bestanden. Ich ging auf ihn zu und streichelte über seinen Arm. Einige Jahre später erinnerte ich ihn in einem fröhlichen Augenblick an diese Szene. Da hatte er nur schallend gelacht. Mir war es damals nicht bewußt, wie isoliert und einsam wir in unserem abgelegenen Dörfchen lebten. In Thorn wurde die deutsche Minderheit von Jahr zu Jahr kleiner. In der Niederung war meine Altersgruppe arg zusammengeschmolzen. Wir hatten uns mehrere Jahre regelmäßig am ersten Sonntag im Monat getroffen. Es waren zehn, manchmal auch zwölf oder dreizehn Jungen. Unsere einheitliche Kluft bestand aus weißen Hemden und schwarzen kurzen Hosen. Später kam eine Windjacke hinzu, aber nur für diejenigen, deren Eltern sich dieses Kleidungsstück leisten konnten. Das Programm wurde von uns von Mal zu Mal festgelegt. Eine Zeitlang spielten wir auf dem Mühlenberg in Rossgarten "Räuber und Gendarm" oder "Indianer auf dem Kriegspfad". Dann bildeten wir zwei Mannschaften und spielten ein halbes Jahr lang oder noch länger Fußball gegeneinander. Diese harmlosen Treffen erregten bald das Mißtrauen unseres polnischen Dorfpolizisten. Als wir uns einmal auf unserem Hof versammelt hatten und auf der Kälberwiese Fußball zu spielen begannen, sahen wir, wie er sich auf dem Fahrrad von der Chaussee her unserem Hof näherte. Wir sahen ihn, bevor er uns entdeckt hatte. Sofort waren wir in einem nahegelegenen Maisfeld verschwunden. Einer von uns [114] wurde zum Beobachtungsposten ernannt. Er schlich wie ein richtiger Indianer bis an den Rand des Feldes. Da der schon über einen Meter hoch war, bot er ihm eine Deckung, wie man sie sich nicht besser vorstellen kann. Von Zeit zu Zeit kam er leise zu uns gekrochen und berichtete mit flüsternder Stimme seine Beobachtungen. Der Polizist hatte den Sturmriemen unter das Kinn gelegt. Er fuhr zielstrebig mit todernster Miene an unserem Maisfeld vorbei. Wir hatten uns dicht zusammengedrängt und waren mäuschenstill. In dieser Stellung warteten wir, bis unser Vorposten berichtete, daß der strenge Ordnungshüter sich von unserem Hof in entgegengesetzter Richtung entferne. Was war geschehen? Der Polizist hatte im Kuhstall dem dort anwesenden polnischen Schweizer gesagt, bei ihm sei eine Anzeige eingegangen, daß hier eine Versammlung stattfinde. Da sie nicht angemeldet und genehmigt sei, müsse er sie auflösen. Unser Melkermeister hatte ihm geantwortet, er wisse nichts von einer Versammlung. Mit dieser Auskunft hatte sich der Dorfpolizist zufrieden gegeben, war auf sein Fahrrad gestiegen und weitergefahren. Für uns war das ein aufregendes Abenteuer. Wir hatten eine Kriegslist angewendet und unseren Gegner mit Erfolg getäuscht. Durch solche Ereignisse wurden wir eine verschworene Gemeinschaft, in die, solange sie bestand, keine Mädchen und auch keine polnischen Jungen aufgenommen wurden. Als ich abends am Familientisch unser aufregendes Erlebnis erzählte, empörte sich meine Mutter am stärksten über den polnischen Wachtmeister. Mein Vater riet zur Vorsicht. Ich hätte als Führer der Jugendgruppe eine Verantwortung den Eltern der Jungen gegenüber. Wir sollten uns möglichst unauffällig verhalten und die Polen nicht provozieren |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|
![]() Volker J. Krüger, heim@thorn-wpr.de
Volker J. Krüger, heim@thorn-wpr.de
letzte Aktualisierung: 30.07.2004