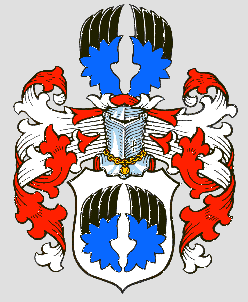
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Betriebsklima und Arbeitswirtschaft |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
Es waren nicht die polnischen Arbeiter auf unserem Hof, es waren immer nur die übergeordneten Behörden, die Presse, ja, ich muß es leider auch sagen, der katholische Klerus, die Zwietracht zwischen die deutschen Arbeitgeber und die polnischen Landarbeiter säten. Der polnische Staat forderte die ehemaligen Immigranten im Ruhrgebiet auf, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Viele sind diesem Ruf gefolgt. Eine Familie kam auch zu uns. Ihr Name deutete zweifellos darauf hin, daß ihre Vorfahren vor ein oder zwei Generationen aus Polen ausgewandert waren. Sie hatte, wie allgemein üblich, sehr viele Kinder. Ich weiß nicht einmal mehr, ob sie alle mit den Eltern nach Polen zurückgekehrt sind. Der Vater und drei Söhne begannen jedenfalls, auf unserem Hof zu arbeiten. Sie waren alle intelligent und tüchtig, bis auf eine Ausnahme. Das war der Jüngste, er hieß Silvester. Wenn mein Vater ihn bei kleinen Diebstählen erwischt hatte, ging er mit ihm zu dessen Mutter und fragte sie, ob sie das gutheißen könne. Sie hatte einmal bei einer solchen Gegenüberstellung geantwortet, da könne sie nichts machen. Der Junge sei in der Silvesternacht geboren und deswegen ihrer Erfahrung nach nun einmal nicht ehrlich. Mein Vater hatte sich mit dieser Erklärung zufriedengegeben, denn es waren ja nur wenige Eier, die er geklaut hatte. Er wollte mit seinen Leuten, wie er sie nannte, langfristig vertrauensvoll zusammenarbeiten. Mit einem älteren Bruder von Silvester, der Gespannführer bei uns war, hatte ich mich angefreundet. Er hatte eine gute Schulausbildung im Ruhrgebiet genossen, konnte einwandfrei deutsch und polnisch lesen und schreiben. Wir werden ihm später in einem anderen Zusammenhang wieder begeg[83]nen, denn die Familie Beszczynski wechselte nicht ihren Arbeitsplatz so häufig, wie andere polnische Arbeiterfamilien es taten. Die Deutschen waren beständiger und disziplinierter. Ich will damit aber nicht sagen, daß sie auch fleißiger waren. Über alle Kritik erhaben war Gustav Wunsch. Er war in meinen Augen ein alter Mann, der mit seinem dunklen Stoppelbart einen düsteren Eindruck auf mich machte. Sehr viel liebenswerter fand ich seine Tochter Mariechen, die lange Jahre mein Kindermädchen war, die mich vorbildlich betreut hatte und an der ich wie eine Klette hing. Gustav Wunsch war nicht Deputatarbeiter wie die anderen Arbeitskräfte, sondern er war Eigentümer eines Nebenerwerbsbetriebes von vier Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Sein kleiner Hof wurde von ihm und seiner Familie bewirtschaftet. Eine eigene Anspannung und eigene größere Maschinen hatte er nicht. Für sämtliche Feldarbeiten lieh er sich Pferde, Wagen und Maschinen von unserem Hof aus. Diese Leistungen seines Arbeitgebers wurden nach festliegenden Sätzen als Bestandteil des Lohnes verrechnet. Gustav Wunsch hatte eine recht umfangreiche Viehhaltung: fünf Kühe, Jungvieh, Schweine, Hühner, Enten und Gänse. Die Futtergrundlage seines Hofes, der etwa sechs Kilometer von Altthorn entfernt war, reichte nicht zur Versorgung der umfangreichen Viehhaltung. Deswegen hatte er Grünland des Weichseldammes in Altthorn gepachtet. Die Heuernte dieser Wiesen wurde ebenfalls mit Gespannen und Wagen des Hofes durchgeführt. Gustav Wunsch konnte alles. Seine Haupttätigkeit lag im Handwerklichen. Er beherrschte den Hufbeschlag, sämtliche Schmiedearbeiten, konnte Wagenräder bauen, tischlern, Strohdächer decken, Schuhe besohlen und Pferdegeschirre sattlern. Wenn zur Erntezeit auf dem Feld ein tüchtiger Mäher fehlte, so sprang er ein. Am Abend vor einem solchen heißen Erntetag war es für ihn Ehrensache, seine Sense so zu dengeln, daß sie wie "Gift" schnitt. Das Blatt wurde von ihm auf einem kleinen Amboß mit einem Spezialhammer solange geklopft, bis die Schneidfläche einen Grashalm mühelos durchtrennte. [84] "Kälberzähne" hat Wunsch nie reingehauen; das überließ er manchmal mir, aber nur dann, wenn er ganz gutgelaunt war. Nicht selten griff er als Stellvertreter meines Vaters und Vertrauensmann der Familie auch in unsere Erziehung ein. Dabei ging es immer darum, uns zur Ordnung anzuhalten. Für uns war es in seiner Schmiede und in seiner Tischlerwerkstatt äußerst interessant. Wenn wieder einmal ein Werkzeug fehlte und wir in seine Nähe kamen, brauchte er nur nach hinten zu greifen, wo die Schnalle seines Leibriemens saß, dann fielen uns sofort unsere Übeltaten ein, und der verschwundene Hammer war bald wieder an seinem Platz. Es ging das Gerücht um, Wunsch hätte einmal mit seinem Riemen Ernst gemacht. Ich habe das niemals geglaubt. Respekt hatte ich vor ihm aber trotzdem. Es muß an etwas anderem als an dem Leibriemen gelegen haben.Wenn mein Vater mit Gustav Wunsch sprach, steckten sie immer die Köpfe zusammen und redeten plattdeutsch miteinander. Ich hatte immer das Gefühl, als ob mein Vater auf das Bedürfnis von Wunsch, als Mensch geachtet zu werden, besonders Rücksicht nahm. Er war der Jüngere. Wunsch hatte ihn schon als Kind gekannt. Jetzt war mein Vater sein Vorgesetzter, sein Ausbeuter, würden Karl Marx und die Sozialisten aller Schattierungen sagen. Da mein Vater es nicht war und schon mein Großvater stets den Kompromiß mit ihm gesucht und gefunden hatte, er sich also menschlich gerecht entlohnt und behandelt gefühlt hatte, war ein unerschütterliches Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Familien gewachsen. Gustav Wunsch wußte, daß er die höchste Stufe erklommen hatte, die ein bäuerliches, mittelständisches Unternehmen zu vergeben hatte. Er bezog im übrigen sein Selbstbewußtsein aus seinem kleinen Hof. Die polnischen Deputatarbeiter hatten im Vergleich zu Gustav Wunsch einen minderen sozialen Status. Das machte sie unzufriedener, und deswegen wechselten sie auch häufig den Arbeitsplatz. Die Familie Beszczynski bewohnte eine Hälfte eines neuen Landarbeiterhauses, das mein Vater bauen gelas [85]sen hatte. Die andere Hälfte war die Schweizerwohnung. Beide Familien hatten einen großen Garten, mästeten Schweine, hielten Hühner und Enten. Ihre materiellen Bedürfnisse waren also befriedigt. Polnische Landarbeiterfamilien, die arbeitsam und sparsam waren, hätten einen genauso hohen Lebensstandard haben können wie die Familie Wunsch. Ihre nichtmateriellen Bedürfnisse blieben jedoch notleidend, weil sie außer ihrem Hausrat und einem geringen Viehbestand kein Eigentum hatten. Gerade dies wollten aber die polnischen Sozialisten abschaffen, die sich am sowjetischen Modell orientierten.Eine ständige seelische Belastung der polnischen Familien auf unserem Hof ergab sich auch aus dem sozialen Umfeld. In Thorn war aus einer polnischen Minderheit in wenigen Jahren eine überwältigende Mehrheit geworden, die sich uns Deutschen gegenüber aus nationalistischen Motiven heraus immer feindseliger gebärdete. Die Angriffe in der Thorner und der Posener polnischen Presse auf die deutsche Minderheit wurden von Jahr zu Jahr unerträglicher. Sie gipfelten in der Forderung, die Deutschen so schnell wie möglich aus Polen auszuweisen oder ihnen die kulturelle und wirtschaftliche Existenzbasis zu entziehen. Dies alles hat sich selbstverständlich auch auf das Betriebsklima in Altthorn ausgewirkt. Mußte es nicht zwangsläufig wie ein Schock auf unsere polnischen Landarbeiter gewirkt haben, als mein Vater eines Nachts von dem Ortspolizisten verhaftet und wie ein Verbrecher in den Runden Turm in Thorn, dem berüchtigten Stadtgefängnis, eingeliefert worden war? Jeder Mensch hat das seelische Bedürfnis, in einem Betrieb zu arbeiten, der sich im Einklang mit seiner sozialen Umwelt befindet und dessen Leiter auch in dieser Beziehung makellos ist. Was war geschehen? Mein Vater hatte sich, als er durch Hof und Familie nicht mehr so stark gebunden war, in den Vorstand der Thorner Vereinsbank und der Molkereigenossenschaft wählen lassen. Beide Institutionen hatten deutsche Vorstände, die sich zur Aufgabe gestellt hatten, die wirtschaftliche Existenz der regionalen [86] deutschen Landwirtschaft zu stärken. Das ist selbstverständlich den Behörden nicht verborgen geblieben, die die polnischen Banken und auch die polnische private Molkerei von Gorski fördern wollten.Da die Niederungsbauern ihre Milch schon aus Solidarität ausschließlich zur deutschen Genossenschaft lieferten, konnte sie der polnische Molkereibesitzer nicht als Lieferanten werben. Seine Absicht wurde schnell durchschaut und durch den deutschen Molkereivorstand durchkreuzt. Da bot sich für die polnische Justiz eine günstige Gelegenheit, die Bauern und ihre deutsche Genossenschaft zu treffen. Bei einer behördlichen Milchkontrolle waren Unregelmäßigkeiten in der deutschen Molkereigenossenschaft festgestellt worden. Daraufhin begann im "Slowo pomorskie", einer Thorner Zeitung, eine Pressekampagne mit dem Tenor: Deutsche Bauern fälschen die Milch, und polnische Kinder müssen sie trinken. Der gesamte Vorstand der Zentralmolkerei wurde verhaftet und in die Zellen des Stadtgefängnisses zusammen mit Kriminellen eingesperrt. Einer der wegen Falschmünzerei Inhaftierten war ein talentierter Kunstmaler und sang in der Zelle meines Vaters oft mit schallender Stimme den damaligen Schlager: "Gern hab ich die Frau' n geküßt". Wie sich später herausstellte, waren auch Spitzel in den Zellen eingeschleust, die der Staatsanwaltschaft über alle Gespräche berichteten, die von den Häftlingen geführt wurden. Die Verhaftung und ihre Hintergründe erregten in der Öffentlichkeit großes Aufsehen. Mein ältester Bruder Werner stand zu der Zeit im Thorner Gymnasium kurz vor dem Abitur. Er hatte zufällig eine etwas hellere Tinte. Das veranlaßte den polnischen Lehrer, ihn zu fragen, ob er es genauso halte wie sein Vater, Wasser in die Tinte zu gießen, so wie Joachim Krüger es mit der Milch mache. Derselbe Lehrer hatte meinen Bruder wegen mangelhafter polnischer Sprachkenntnisse durch das Abitur rasseln lassen. Man muß zugeben: Ein bißchen viel Skat hatte er vor dem Abitur gespielt, anstatt polnisch zu lernen. Nach dreiwöchiger Haft wurden die Vor [87]standsmitglieder der Molkereigenossenschaft ohne Gerichtsverhandlung entlassen. Die Justiz konnte ihnen keine Beteiligung und auch nicht einmal die Mitwisserschaft an den im Dunkeln gebliebenen Vorkommnissen in der Molkerei nachweisen. "Unsere deutsche Zentralmolkereigenossenschaft sollte geschädigt werden" sagte mein Vater, als er nach Hause gekommen war. "Ich habe nichts nach dem Gesetz Strafbares begangen. Wenn wir gleichberechtigte Staatsbürger sind, dann werden wir uns in dem freien Spiel der Kräfte weiterhin behaupten." Das klang so, als vertraute er trotzdem auf die rechtsstaatliche Gesinnung von Marschall Pilsudski, der inzwischen autoritärer Staatschef geworden war. Die kurze demokratische Periode Polens war zu der Zeit schon beendet. Die unteren Verwaltungsbehörden und die Justiz hatten sich in nationalistischem Übereifer übernommen. Das Vertrauensverhältnis meines Vaters zu seinen polnischen Landarbeiterfamilien war aber durch diesen Vorfall gestört.Die Solidarität der Niederungsbauern untereinander und mit ihren Genossenschaften wuchs. Die polnischen Behörden hatten das Gegenteil von dem erreicht, was sie wollten. Auf dem Molkereiwagen der polnischen Molkerei in Thorn standen immer weniger Milchkannen, bis sie schließlich die Milchabfuhr aus der Niederung ganz einstellen mußte. In diesem Zusammenhang ist eine kleine Geschichte recht aufschlußreich für den Charakter meines Vaters. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, den Kunstmaler aus dem Gefängnis bei sich zu Hause zu resozialisieren. Er hatte mit dem Zelleninsassen verabredet, er werde ihn nach der Entlassung in seinem Hause aufnehmen und als Maler in Lohn und Brot setzen. Das geschah dann auch. Er ließ ihn den Flur unseres Wohnhauses, den Treppenaufgang und die obere Diele, von der aus eine breite Glastür zum Balkon herausführte, neu ausmalen. Der Kunstmaler arbeitete fleißig und war ein wohlgelittener Hausgast mit vollem Familienanschluß. Eine Freske im Treppenaufgang hatte sogar künstlerischen Wert. Sie stellte einen nackten jungen Ritter dar, der auf einem [88] prächtigen Pferd saß, auf dem auch Achilles gegen Troja hätte geritten sein können. Der Jüngling holte mit einer Lanze aus und wollte sie gerade gegen einen Feind schleudern. Welcher Art der Widersacher war, davon gab es auch nicht die geringste Andeutung. Bald nachdem diese Freske beendet war, verschwand der Sänger und Maler bei Nacht und Nebel. Er zog es vor, künftig lieber Klischees für Geldscheinblüten zu entwerfen als nackte Ritterjünglinge auf fülligen Streitrössern in deutschen Bauernhäusern zu malen. Mein Vater war um eine Erfahrung reicher geworden.Wenn die Getreideernte nahte, bemächtigte sich des ganzen Hofes eine angespannte Unruhe. Es war wie eine kleine Mobilmachung. Sensen wurden gedengelt, den Pferden etwas Hafer zugelegt, die Mähmaschinen geölt, der Dreschsatz in Stellung gebracht. Der hohe Aufwand an Arbeitskräften beim Erntehofdrusch hatte meinen Vater schon viele Jahre geärgert. Einen Ansatzpunkt, Abhilfe zu schaffen, sah er in der Mechanisierung der Strohförderung hinter der Dreschmaschine. Wenn der Strohschober beim Dreschen höher und höher wuchs, waren bis acht Personen nur für diese Arbeit erforderlich. Der Bedarf an Arbeitskräften konnte auf eine bis zwei Personen verringert werden, wenn ein Strohelevator vorhanden gewesen wäre. Derartige Geräte waren im Reich zur Selbstverständlichkeit geworden, in Polen wurden sie industriell nicht hergestellt. Gustav Wunsch, der Mann, der alles konnte, mußte ran und hatte tatsächlich nach einem Entwurf meines Vaters einen Strohelevator gebaut. Das war für mich ein technisches Wunderwerk. Ich stand oft in der Werkstatt und beobachtete die drei oder vier Männer, die geschickt die einzelnen Glieder der Förderkette schmiedeten. Mein Bruder Hans-Joachim beriet meinen Vater, wie sie im glühenden Zustand zu formen und zu härten seien. Er war schon im dritten Jahr seiner Schlosserlehre und erwies sich als ein fachmännischer Gesprächspartner meines Vaters. Er war das erste Familienmitglied, das sich den Beruf des Technikers ausgesucht hatte. Als das Wunderwerk fertig war, wurde es unter Staunen der Anwesenden an die Dreschmaschine ge [89]schoben und der Transmissionsriemen aufgelegt. Alles schien zu passen und zu funktionieren. Beim nächsten Dreschtag sollte das Gerät praktisch erprobt werden. Jetzt war das letzte Glied an die technisierte Arbeitskette der Getreideernte angefügt. Der Erntedrusch konnte beginnen.Die ersten beiden hoch mit Wintergerste beladenen Erntewagen standen bereit. Sie waren schon am Tage zuvor herangeschafft worden, damit pünktlich auf die Minute zum Arbeitsbeginn, wenn Gustav Wunsch die Pfeife an der Dampfmaschine schrillen ließ, die erste Garbe auf die Dreschmaschine gereicht werden konnte. Mit lautem Gezische wurde der Dreschsatz in Gang gesetzt. In der Tat, es klappte vorzüglich. Auch der Strohelevator setzte sich in Gang. Nicht ohne Erfinderstolz stellte sich mein Vater unter ihn und betrachtete sein Werk. Das erste ausgedroschene Stroh fiel, ohne von Menschenhand berührt zu werden, auf die Stelle herunter, wo der Strohschober später stehen sollte. Mein Vater kannte dieses Gefühl des Triumphes aus dem Kriege, wenn er mit dem von ihm konstruierten Lichtmeßgerät seine Batterien nachts einschoß und die Einschläge sich immer mehr dem Ziel näherten. Einen Volltreffer hatte er auch jetzt gelandet. In diesem Moment riß das Zugseil der Hebevorrichtung und der Höhenförderer krachte herunter. Da lag der baumlange Mann, am Kopf verletzt, gestrauchelt auf dem Felde der rationalisierten Arbeitswirtschaft. Gustav Wunsch kam angerannt, strich sich die ölverschmierten Hände an der Manchesterhose ab, die auf den Knien immer ausgebeult war, packte seinen Herrn, schlang dessen Arm um seinen Hals, hob ihn hoch und schleppte ihn nach Hause, so wie Soldaten ihren verwundeten Kameraden aus der Feuerlinie holen. Als sich meine Mutter den Unfallbericht angehört hatte, machte sie dem unglücklich dreinschauenden Gustav Wunsch völlig ungerechtfertigte Vorwürfe. Wie er es hätte soweit kommen lassen können, daß "dem Herrn" so etwas zustoßen konnte. In Zukunft solle er ein stärkeres Seil nehmen, wenn es den Elevator nicht aushalte, den er ja schließlich selbst gebaut habe. Alles könne der Herr nun [90] doch nicht alleine bedenken. Ihn hätte ja auch ein Zinken dieser furchtbaren Strohrechen am Kopf treffen können.Die Getreideernte wurde auch ohne persönliche Mithilfe meines Vaters termingerecht beendet. Für alle Beteiligten war es eine heilsame Erkenntnis: Es geht auch ohne einen ständigen Aufpasser, sagte sich mein Vater. Die Arbeit macht mehr Spaß, wenn man zwischendurch auch einmal den Rücken gerade machen und miteinander reden kann, sagten sich die Landarbeiter. Gustav Wunsch, die Seele des Hofes, hatte sie die Knute nicht fühlen lassen. Er hatte jetzt das Tagespensum festzulegen und die Durchführung zu überwachen. Es lief unter seiner Leitung alles wie am Schnürchen. In dieser Zeit hatte mein Vater, einem Familiengerücht folgend, manchmal in der Gastwirtschaft, wo die Viehverkäufe regelmäßig besiegelt und begossen wurden, diese dienstlichen Besprechungen bis weit nach Mitternacht ausgedehnt. Hier trafen sich alle Bauern der Niederung, die Schweine oder Rinder verkauft hatten, mit dem Fleischer Dobslaff aus Thorn, spielten einen zünftigen Skat, unterhielten sich über Preise, machten Stammtischpolitik und feuchteten sich dabei die Kehle an, wenn sie vom vielen Reden allzu trocken geworden war. Eine solche Sitzung dehnte sich einmal bis in die Morgenstunden aus. Leise schlich mein Vater auf etwas unsicheren Socken in das Schlafzimmer, zog sich aus, legte sich ins Ehebett und schlief sofort ein. Draußen dämmerte es bereits, und die ersten Vögel begannen vor dem Schlafzimmerfenster auf den hohen Kastanienbäumen, der Traueresche und dem Birnbaum die aufgehende Sonne zu begrüßen. Mein Vater zog abends regelmäßig vor dem Schlafengehen den an der Wand hängenden Regulator auf, indem er das an einer Kette hängende Gewicht hochhob und mit der linken Hand die andere Kette herunterzog. Der Wecker dieser Uhr klingelte dann im Sommerhalbjahr um fünf Uhr und dreißig. Dann stand mein Vater auf, weckte die Hausmädchen und ging in den Kuhstall und Pferdestall, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei, die Gespannführer und der Schweizer zu füttern begonnen hatten. Diese Handgriffe an dem Regulator waren für ihn [91] nicht nur allabendliche Gewohnheit, sondern eine betriebliche und familiäre Institution. Ohne sie wäre morgens der Betrieb nicht pünktlich in Gang gekommen und wäre unser Leben in Unordnung geraten. Das durfte auf keinen Fall geschehen. Das Chaos wäre ausgebrochen. Heute war dies Undenkbare eingetreten. Meine Mutter stellte sich schlafend und beobachtete, unter der Bettdecke hervorblinzelnd, daß ihr stets vorbildlicher Mann es übersehen hatte, den Wecker aufzuziehen. Er war gerade fest eingeschlafen, als dieser eigentlich hätte klingeln müssen. Meine Mutter stand auf, weckte die Hausmädchen und machte die üblichen Kontrollgänge durch die Ställe. Als sie in das Schlafzimmer zurückkam, schlief mein Vater immer noch tief und fest.Der Zeitpunkt des allgemeinen Arbeitsbeginns auf dem Hof nahte. Die Männer und Frauen hatten sich vor dem Pferdestall versammelt und warteten auf "den Herrn". Meine Mutter kannte nicht den vorgesehenen Tagesplan, rüttelte meinen Vater an der Schulter: "Joachim, wach auf. Die Leute wissen nicht, was sie tun sollen." Er drehte sich mit einem Riesenschwung im Bett herum, streckte seiner lieben Frau den nackten Hintern entgegen und grunzte: "Sie sollen meinetwegen Saatkrähen greifen." Das stelle man sich einmal vor. Der tüchtige, geschickte Gustav Wunsch, sein Sohn Max, der alte Beszczynski und die Frauen, wie sie alle den scheuen Saatkrähen nachstellen. Unmöglich, was "der Herr" von uns verlange. Wie könne er solche Anweisungen geben, wo er doch jeden nicht sorgfältig ausgeführten Auftrag streng als Befehlsverweigerung einstufe. |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|
![]() Volker J. Krüger, heim@thorn-wpr.de
Volker J. Krüger, heim@thorn-wpr.de
letzte Aktualisierung: 30.07.2004