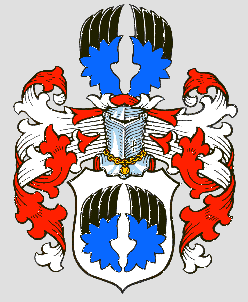
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Nullpunkt |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
Wir fanden uns wieder, soweit wir überlebt hatten. Ich fragte mich, ob das 'wir' noch einen Sinn hat. Jeder von uns war durch die Erlebnisse in seiner Persönlichkeit geprägt worden, zum Guten und zum Bösen. Wenn ein hartes Schicksal, wenn schwere Prüfungen die Vorbedingung für die menschliche Reifung sind, so hatten wir diesen inneren Entwicklungsprozeß durchlebt, jeder auf seine Weise. Die Schlußfolgerungen aus seinem Erleben zog jeder von uns individuell. Die Geschichte hatte uns eine Lehre erteilt. Sie hatte mit Bomben, Panzern, Stalinorgeln, östlicher und westlicher Hetzpropaganda, Umerziehung, Enteignung und Vertreibung Gericht über uns gehalten. Wir waren für eine glücklichere Zukunft angetreten, die uns Hitler verheißen hatte. Sie war in Strömen von Blut und Tränen erstickt. Wir stritten uns in der Familie darüber, wer den Verführer zuerst durchschaut hatte. Die Besessenheit unserer Gehirne durch ihn war eines Tages verflogen, wie sich Nebel in den Strahlen der aufsteigenden Sonne auflöst, bei dem einen früher, beim anderen später. Wer totalitäre Ideologien und Diktaturen nicht am eigenen Leibe erlebt hat, kann nicht mitreden. Wir alle waren keine Helden. Wichtiger ist der Blick in die Zukunft, sagten wir uns. So etwas darf sich nicht wiederholen, dafür stehen wir ein. Das war damals das ‚wir' unserer Familie, ein negatives Über-Ich, noch kein positiver Wert. Den nächsten Schritt darüber hinaus mußte jeder von uns in einer vollkommen veränderten Welt allein tun. Wir waren frei. Jedenfalls sagten das die Besatzungsmächte, die kommunistische im Osten und die demokratischen im Westen. Wem sollten wir glauben? Am besten ist es, keinem Politiker Glauben zu schenken. Die Werte, die uns unser Vater und unsere Mutter [247] anerzogen hatten, sind von den Nazis mißbraucht worden. Unsere Ehre, die kulturellen Leistungen unserer Vorfahren, ihre harte bäuerliche Arbeit, ihre gemeinnützigen Werke waren in den Gaskammern von Auschwitz verbrannt worden. Wie konnte man überhaupt noch zu einem positiven, Werte bejahenden Gefühl zurück finden? Ehre entspringt einer natürlichen Autorität. Man erwies sie unserer Familie bis zu dem Zeitpunkt, als die braunen Uniformen in der Niederung die Bühne betraten. Wer erwies sie uns jetzt? Keiner kannte uns, keiner wußte, wo Altthorn liegt, keiner wollte etwas davon wissen, daß unsere Familie überhaupt jemals eine geachtete Rolle gespielt hatte. ‚Wo seid Ihr denn schon hergekommen? Ja, ja, wir wissen schon, aus großen Häusern, da wo die Herrschaften herkommen, von großen Gütern, deren Parks so groß waren wie zwei Bauernhöfe hierzulande. Aus Rattenlöchern seid Ihr gekommen, aus Polen, von dort, wo sich die Hasen und Füchse gute Nacht sagen, wo die Wölfe nachts heulen. Hier im Westen gebt Ihr eine Stange an. Arme Schlucker seid Ihr, Zigeuner, die man so schnell wie möglich wieder fortschickt. Zeigt doch erst einmal, was Ihr seid. "Mehr sein als scheinen" habt Ihr Preußen uns doch immer gepredigt. Verhaltet Buch danach.' Solche Ansichten wurden in den bäuerlich und bürgerlich geprägten Dörfern und Städten Westdeutschlands oft geäußert. ‚Kommt als Arbeiter zu uns, dann werden wir sehen, was Ihr leisten könnt.' Das zweite 'wir' bestand für uns darin, geistig, gesellschaftlich und wirtschaftlich vom Nullpunkt anzufangen. Das Hemd saß uns näher als der Rock. Jede Kleinfamilie, die von Werner und Ilse, von Hans-Joachim und Ursula, von meinen Schwestern Ursula und Edith, bemühte sich, ein Dach über dem Kopf zu finden und betete mit Inbrunst "unser täglich Brot gib uns heute". Ich war noch ledig und machte mir wenig Gedanken um Essen und Trinken, dafür umso mehr um die Fortsetzung meines Studiums. In Göttingen sollen, so hörte ich, die Vorlesungen an der naturwissenschaftlichen Fakultät im Wintersemester [248] 1945/46 beginnen. Ich machte mich auf den Weg, um mich dort anzumelden. In Stubben stieg ich in den Zug nach Bremen. Zunächst ging's flott voran. In Bremen mußte ich umsteigen. Die Deutschen sind alle verseucht und verlaust. Wir alle, die wir in den Zug nach Hannover umsteigen wollten, wurden in einen Entlausungsraum geschleust. Wir mußten vorne die Jacke aufknöpfen. Ein Hilfswilliger der englischen Besatzungstruppen steckte eine etwa einen halben Meter lange Spritze bis zum Bauchnabel unter das Hemd, blies das Entlausungspulver so kräftig aus ihr heraus, daß sich der Wohltäter in einer Staubwolke eingehüllt meinen Blicken entzog. "Umdrehen", kommandierte er. Jetzt mußte ich vor ihm einen tiefen Diener machen. Ist denn das mit der Menschenwürde eines freien Bürgers noch vereinbar?, schoß es mir durch den Kopf. Aber ehe ich meine demokratische Staatsbürgerkunde zu Ende denken konnte, saß die Staubspritze unter dem Hemdkragen, und eine zweite Ladung kitzelte den Rücken herunter bis zu einer Stelle, über die ich lieber schweigen möchte. "Weiter gehen", schrie mich undemokratisch der Hilfswillige an. Auf der Fahrt von Stubben nach Göttingen mußte ich viermal umsteigen, in Bremen, in Verden, in Nienburg und in Hannover, und wurde auf den Bahnhöfen viermal entlaust. Die neue Ordnung, die sich auf den zerstörten Bahnhöfen regte, war hygienisch. Keine Transparente hingen über die Straße, keine Parolen an den kahlen Bahnhofswänden. Statt dessen: Entlausung. An der Georgia Augusta in Göttingen konnte ich mich als Student der Landwirtschaftswissenschaften für das vierte Semester einschreiben. Nun hatte ich wieder eine Perspektive, eine berufliche Zukunft, keine sehr Erfolg versprechende, aber immerhin die Aussicht auf eine berufliche Zukunft. Wir sind bescheiden geworden. Auch das war uns gemeinsam. Ist das nicht auch ein Wert, wenn man den Sinn des Lebens darin sieht, eine Karriere als Mensch zu machen? Bei allem Pluralismus verbanden uns unsere Erinnerungen. Wir hatten alles verloren, was dem bürgerlichen Leben einen Sinn gibt: Heimat, Freunde, Eigentum, Existenz, die Familiengrä[249]ber auf dem Gursker Kirchhof, die Nummer drei im Massengrab auf dem Altstädtischen Friedhof in Thorn, Stilmöbel der Gründerzeit, Wäschestapel, die von Generation zu Generation in großen Schränken vererbt wurden, Familiensilber in Glasvitrinen. Was uns geblieben ist und was wir verinnerlichten, waren unsere Erinnerungen an große Häuser, glückliche Jugend, blühende Bauernhöfe und Familienfeste. Wir verproletarisierten nicht, so wie es diejenigen hofften, die im Osten und im Westen die Internationale sangen. Ein Zuwachs von dreizehn Millionen Deutschen, die trotz allem in Ost und West in dem Ruf standen, fleißig und intelligent zu sein, für die roten Fahnen der Weltrevolution wäre ein schöner Happen für Stalin gewesen. Sahen das die Angelsachsen nicht, die bei uns als politisch besonders klug galten? Sie waren mit Blindheit geschlagen oder wollten den Bankrott ihrer Europapolitik der Balance of Power nicht sehen. Für uns war nur das Äußere, die Hülle des Lebens für immer und ewig weggefegt von einem Wind, den Hitler entfacht hatte und den Stalin, Roosevelt und Churchill zum Orkan steigerten. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das war die eine Lehre, die uns die verworrene Geschichte erteilt hatte. Die zweite Lektion hatte uns unser Vater mit auf den Weg gegeben: Was Ihr im Kopf und im Herzen habt, kann Euch keine Macht der Welt nehmen. Mit diesem Funde wucherten besonders die Frauen in unserer Familie. Auf unseren Bauernhöfen der vorindustriellen Gesellschaft waren sie nie die Heimchen hinter dem Herd. Meine Mutter war im Ersten und im Zweiten Weltkrieg selbständig disponierende Unternehmerin, Ursula hatte in Altthorn und später in Großputz einem großen ländlichen Haushalt vorgestanden, Edith hatte von Kindes Beinen an ein unerschütterliches Selbstvertrauen. Sie packte die Aufgaben, die sie sich stellte, stets mit Energie und Verantwortungsbewußtsein an. Auch meinen Schwägerinnen Ilse und Ursula hatte es niemand an ihrer Wiege gesungen, daß sie aus ihrer Heimat fliehen und in einer fremden Umwelt [250] ganz unten neu beginnen mußten. Jede der fünf Frauen war durch ihr Erleben ungebrochen. Am traurigsten waren die beiden Ursulas. Meine Schwester, weil sie eine herausgehobene Rolle in Großputz gespielt hatte und sich jetzt in einer engen Flüchtlingswohnung wiederfand, weil ihr Mann vermißt und nicht tot gemeldet war. Meine Schwägerin bedrückte, daß sie, die von ihren Eltern als einzige Tochter sehr verwöhnt worden war, die Heimat und auf der Flucht ihre Gudula verloren hatte. Beide fanden sich in einer Wirklichkeit wieder, mit der sie sich nicht identifizieren konnten. Ihre Erinnerungen belasteten sie und gaben ihnen nicht die seelische Kraft, die die anderen Frauen der Familie aus ihnen bezogen. Uns allen wurde durch Hunger, Not und soziale Deklassierung ein Höchstmaß an psychischer Widerstandsfähigkeit abverlangt. Von der Gesellschaft waren keine Hilfen zu erwarten, denn sie und ihre Institutionen waren in ihren Grundlagen erschüttert oder gänzlich zusammengebrochen. Eine staatliche Ordnung gab es nicht. Wenn die Kommunen in dieser Lage nicht Großes in Bezug auf Wohnungsbeschaffung, Bereitstellung von Gemüseland und Heizmaterial geleistet hätten, wäre die Last, die auf den Frauen bei der Befriedigung unserer Grundbedürfnisse lastete, noch größer und noch unerträglicher gewesen. Die Nachkriegsereignisse hätten den Bestand unserer Familie im höchsten Maße gefährdet, wenn meine Mutter nicht mit Güte, nie versiegender Hilfsbereitschaft und Liebe dort eingesprungen wäre, wo die Not am größten war. Finanzielle Mittel standen ihr, wie uns allen, nicht zur Verfügung. Sie half bei der Kindererziehung, lief bei den Bauern von Haus zu Haus, bettelte um ein Ei und einen Liter Milch. In ihrer großen Tasche und in der Milchkanne war immer eine Überraschung, wenn sie zurückkam. Die Gemeinde teilte uns auch bald Essenmarken zu, so daß wir wenigstens Nährmittel in ausreichendem Maße kaufen konnten. Meine Mutter sorgte auch dafür, daß sich Ursula und Edith mit ihren Kindern in einem Akt der Selbsterhaltung zu einer neuen Familie zusammen[251]schlossen. Sie wollte mich dafür gewinnen, die Rolle des Vaters zu übernehmen. Das lag nahe, denn ich hatte drei Pferde aus Altthorn wieder gefunden, mit denen unser Dorfpolizist mit seiner Familie und unser Verwalter geflohen, waren. Bald nach meiner Entlassung aus der Gefangenschaft gründete ich ein Fuhrunternehmen. Arbeit gab es in Hülle und Fülle bei den Kleinbauern, die keine eigene Anspannung hatten, bei den Evakuierten aus Bremen und Bremerhaven, denen ich Möbel und Hausrat in ihre städtischen Wohnungen zurück brachte. Die Frauen waren so glücklich darüber, daß sie mir, nachdem ihre Wohnungen wieder eingeräumt waren, zweihundert oder dreihundert Reichsmark in die Hand drückten. Das war manchmal einhundert Mark mehr, als ich verlangt hatte. In der Umgebung von Bokel gibt es große Moore. Die Gemeinde stellte uns Flächen kostenlos zur Verfügung, auf denen wir Torf stechen konnten. Edith und ich wetteiferten mit den alten Moorarbeitern. Wir versorgten unsere Familie, die ich einmal und nie wieder bei einer Tischrede als Restfamilie bezeichnet hatte, mit Heizmaterial für den Winter. Es war eine große Enttäuschung für meine Mutter und für meine Schwestern, als ich die Vaterrolle der neu gebildeten Familie nicht übernahm, sondern mich nach Göttingen absetzte. Die Notlage, in die wir hineingeraten waren, schien mir von unabsehbarer Dauer zu sein. Mein Fuhrunternehmen warf genügend Geld ab, mein Studium in Göttingen zu finanzieren, war aber auf weitere Sicht keine Existenzgrundlage für meine Mutter, zwei Schwestern, vier Kinder und mich. Wir durften in einer fremden Umwelt, in der chaotische Bedingungen herrschten, in der Millionen Menschen ohne Existenz waren und das Schicksal mit unserer Familie teilten, nicht mehr in traditionelle, bäuerliche Lebensformen zurück streben. Wir mußten uns, so schmerzhaft das für meine Mutter auch war, in unserer Lebensgestaltung grundsätzlich neu orientieren. Für den Teil unserer Familie, der in Bokel im Hause Terjunk eine so einfühlsame Aufnahme gefunden hatte, bedeutete das, ganz neue Verhaltensweisen zu entwickeln. Erleich[252]tert hat uns dieses Improvisieren in eine ungewisse Zukunft hinein die Tatsache, daß ein großer Teil des deutschen Volkes am Nullpunkt neu beginnen mußte. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn ich behaupte, daß die Zeit unserer schwersten existenziellen Krise auch die Geburtsstunde neuer Verhaltensweisen war. Unsere Großfamilie teilte sich in drei Kleinfamilien, die ihrerseits zu einer vorher nicht gekannten Stabilität fanden. Die unverdrossenste von uns war Edith. Sie übernahm die Pferde von mir und führte die Arbeiten weiter, die ich begonnen hatte. Das ging solange gut und erbrachte ihr bescheidene Einkünfte, bis sich die wirtschaftlichen Verhältnisse zu normalisieren begannen. Edith finanzierte bis zur Währungsreform mit dem durch das Fuhrunternehmen verdienten Geld die gemeinsame Haushaltskasse. Sie übernahm, wenn auch widerstrebend, die Aufgaben des Familienvorstandes. Meine Mutter führte mit Ursula zusammen den Haushalt und machte die Einkäufe. Alle gemeinsam erzogen sie die vier Kinder so gut es eben ging, wobei sich Ursula für Rüdiger und Horst, Edith für Sybille und Renate verantwortlich fühlten. Einer ging seinen Weg alleine: das war ich. Als mit der Währungsreform das Geld wieder einen Kaufwert erhielt, verringerte sich gleichzeitig das Auftragsvolumen des Fuhrbetriebs. Die Bedürfnisse der Familie in Bokel stiegen und mußten jetzt mit Deutscher Mark bezahlt werden. Es wurde Familienrat gehalten und beschlossen, daß Ursula sich um eine Arbeitsstelle in einem nahe gelegenen Chemiewerk bewerben soll. Dieser Schritt, den sie dann auch tat, erforderte Selbstüberwindung für sie. Er führte sie aus der Familie heraus, was für unsere Frauen über alle Generationen hinweg undenkbar, und hinein in einen westdeutschen Industriebetrieb, der für uns ein Buch mit sieben Siegeln war. Die verschlossene und traurige Ursula tat ihn mit dem Mut der Verzweiflung. Sie bewarb sich mit dem folgenden Schreiben vom 20. März 1949. An die Firma Oscar Neynaber A.G. Von Herrn Dr. Michaelis aus Oldenburg hörte ich, daß Sie für [253] Ihren Betrieb eine Kontoristin suchen. Da ich mich seit längerer Zeit um eine Stelle dieser Art bemühe, möchte ich mich an Sie mit der Bitte wenden, mich in Ihrem Betrieb einzustellen. Nach meiner Flucht aus Danzig-Westpreußen lebe ich seit April fünfundvierzig in Bokel. In dieser Zeit war ich nicht berufstätig, da ich für meine beiden kleinen Kinder zu sorgen hatte. Ich habe ein Jahr Handelsschule besucht und durch vierjährige Buchhalterinnenarbeit auf einem landwirtschaftlichen Großbetrieb, den mein Mann leitete, praktische Erfahrungen erworben. Damit glaube ich, die notwendigen Voraussetzungen für meine Bewerbung zu erfüllen, zumal ich durch verantwortliche Tätigkeit die notwendige Reife zu besitzen glaube, um durch Anpassungsfähigkeit, Umsicht und Fleiß mir eine Vertrauensstellung zu erarbeiten. Da mein Mann im Osten vermißt ist und mir außer der Verantwortung für meine beiden Kinder auch die Verpflichtung zufällt, für meine Schwester zu sorgen, die mit ihren beiden Kindern nur von einer kleinen Rente lebt, bitte ich, meine Bewerbung wohlwollend aufzunehmen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Sie traf schon zwei Tage später ein. Frau Ursula Dahlweid, Bokel Nr. 55 Betrifft: Ihre Bewerbung vom 20. 3. 1949 Wir danken Ihnen für Ihre Bewerbung und stellen Sie unter Bezugnahme auf die Unterredung in unserem Werk mit Wirkung vom 22. März 1949 bei uns als Kontoristin ein, zunächst mit 14-tägiger Kündigung zur Probe bis zum 1. Mai 1949. Darüber hinaus ist Ihre Tätigkeit den gesetzlichen Bestimmungen unterworfen. Als Gehalt vereinbaren wir im Hinblick auf Ihre sozialen Verhältnisse zunächst monatlich DM 175,-. Wir sind uns darüber klar, daß Sie arbeitsmäßig unseren Anforderungen zur Zeit noch nicht entsprechen. Es liegt also bei Ihnen, ob Sie sich mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit einarbeiten. Neynaber [254] Ursula hatte in ihrem Bewerbungsschreiben nicht zu hoch gestapelt. Sie hatte die Anlagen für eine Vertrauensstellung und erklomm sie von Stufe zu Stufe. Sie bekam sehr bald ein höheres Monatsgehalt, von dem sie einen steigenden Anteil in die Haushaltskasse einzahlte, und erwarb im Laufe der Jahre die soziale Sicherheit für sich und ihre beiden Söhne, indem sie und ihr Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge zur Krankenkasse, zur Renten- und Arbeitslosenversicherung einzahlten. Ursula war die erste von uns, die als Arbeitnehmerin wieder Boden unter den Füßen hatte.Mein Bruder Werner strebte seit seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft eine selbständige kaufmännische Tätigkeit an, wenn möglich in dem von ihm erlernten Landmaschinenfach. Er fand in Goddelau einen Lohndruschunternehmer, der seinen Betrieb aus Altersgründen einstellen wollte. Seine Werkstatt eignete sich für die Reparatur und Wartung von Landmaschinen. Die Einrichtung und die Maschinen waren veraltet und hatten keinen Gebrauchswert mehr. Werner übernahm sie deswegen nicht. Schon sechsundvierzig zog Hans-Joachim mit seiner Familie nach Goddelau und gründete mit Werner eine Firma, die sie Gebrüder Krüger nannten. Werner war in Thorn ein dynamischer Unternehmer. Seine Konkurrenten im Kreis Groß-Gerau waren Dorfschmiede, die über kleine Handwerksbetriebe verfügten und nur den Bedarf der Bauern ihres eigenen oder der unmittelbar benachbarten Dörfer deckten. Werner aktivierte seine alten Geschäftsbeziehungen zu der Firma Lanz in Mannheim und anderen Landmaschinenfabriken, so daß es in kurzer Zeit gelang, seine kaufmännische Tätigkeit auf die Kreisebene auszudehnen. Herr Arthur Lange, ein langjähriger Mitarbeiter aus Thorn, wurde als Landmaschinenvertreter auf Provisionsbasis angestellt. Er zog mit seiner Frau und zwei Söhnen nach Goddelau. Kurz darauf meldeten sich weitere gelernte Landmaschinenmonteure aus Thorn, die unter der Leitung von Hans-Joachim in der Werkstatt arbeiteten. Darüber hinaus stellte Werner zwei oder drei Gesellen an. In wenigen Jahren wuchs die Firma zu einem mittelständi [255]schen Unternehmen heran.Werner mußte sich schon vor der Währungsreform um neue Büro- und Werkstatträume bemühen, da die Firma aus allen Nähten platzte. Er entschloß sich, ein Wohnhaus und eine Werkhalle zu bauen, denn geeignete Gebäude für sein Unternehmen waren weder in Goddelau noch in den Nachbardörfern vorhanden. Die Wohnungen, die er und Hans-Joachim gemietet hatten, entsprachen nicht einmal den primitivsten Bedürfnissen der beiden Familien. Die Davongekommenen waren aber glücklich vereint und hatten eine Existenz, die zwar keinen Vergleich mit den beiden Firmen in Thorn aushielt, aber immerhin, es war eine. Sehr vielen Flüchtlingen und Vertriebenen ging es schlechter. Werner schrieb mir kurz vor Kriegsende, er sei Optimist. Er sah die Lage als ernst, aber nicht als hoffnungslos an. Das erste im Westen geborene Kind der Familie wurde in der Goddelauer Kirche auf den Namen Doris getauft. Man sagt, der Wunsch, einen Sohn zu haben, sei das Motiv für die Geburt vieler Töchter. Werner und Ilse bekamen schon bald ein weiteres Kind. Es war die vierte Tochter. Die Eltern gaben ihr den Vornamen Ute. Von den Zwillingen, die Hans-Joachim und Ursula bekamen, überlebte nur einer der beiden Jungen. Er heißt Norbert. Meine Schwägerin Ursula wurde durch ein unerbittliches Schicksal wieder hart geprüft. Der Tod des Zwillingsjungen bedrückte die Eltern sehr. Der Goddelauer Zweig der Familie hatte nun aber sieben Kinder, Werner und Ilse vier Töchter, Hans-Joachim und Ursula drei Söhne. Beide Familien mußten sich um größere Mietwohnungen bemühen oder zwei Häuser bauen. Die Entscheidung fiel zu Gunsten von zwei Eigenheimen. Sie wollten Herr in den eigenen vier Wänden sein, so wie sie es aus ihrem Elternhaus kannten. Es hatte zunächst den Anschein, als wäre dieses Problem nicht zu lösen. Werner suchte ein Baugelände. Er fand es am Dorfrand von Goddelau. Es war die sechstausend Quadratmeter große Ziegenwiese. Als er sich beim Bürgermeister danach erkundigte, ob er sie kaufen könne, bekam er die Auskunft, [256] daß sie nicht im Bebauungsgebiet der Gemeinde liege und wegen der Beschaffenheit des Untergrundes nicht als Wohn- und Gewerbegelände ausgewiesen werden könne. Unüberwindliche Schwierigkeiten türmten sich auf. Werner ließ nicht locker und suchte einen Weg. Er nahm Kontakt mit einem Bauunternehmer in Mainz auf, der im Kriege Niederlassungen in Thorn, Warschau und Minsk hatte. Nach gründlicher Untersuchung des Baugrundes arbeitete er einen Bauplan für ein Wohnhaus und für eine Werkstatthalle aus, wonach die Gebäude durch entsprechend tragfähige Betonpfähle zu gründen seien. Werner ging mit diesen Plänen zum Bürgermeister, der ihm nach langen Verhandlungen das Gelände verkaufte. Noch vor der Währungsreform ließ er die Betonpfähle einrammen und das Baugrundstück, die ehemalige Ziegenwiese, auf dem im Winter regelmäßig das blanke Wasser stand, um dreißig Zentimeter bis zu einem Meter mit Schlacke auffüllen. Schon bald nach der Währungsreform wurden das Wohnhaus und eine Werkstatthalle gebaut, in der sich auch die Büroräume befanden. Später kamen im Rahmen des Wachstums der Firma Gebrüder Krüger eine zweite Werkhalle und eine Tankstelle hinzu.Hans-Joachim kaufte ein Baugrundstück in der Friedrichstraße. Er stand stets auf dem Standpunkt, ein Krüger müsse ein großes Haus bewohnen. In einer Mietwohnung verlöre er seine Identität. Das Haus, das er in der Friedrichstraße baute, war im Vergleich zu der Flüchtlingswohnung ein geräumiges Einfamilienhaus, zu ihren Elternhäusern in Altthorn und Bagnitz war es aber sehr klein. Alles ist relativ. Hans-Joachim baute sein Leben lang an und um. Er sagte einmal: "In Altthorn hatte unser Vater auch stets Baumaterial auf dem Hof liegen und baute immer irgend etwas. So will ich es auch halten." Er hatte Glück und fand immer jemanden aus seiner Familie, der ihm dabei half, nicht nur als Handlanger, sondern auch finanziell. So stehen jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, zwei große Einfamilienhäuser in Goddelau, die Werner und Ilse, Hans-Joachim und Ursula gehören. Wie baut man als arme Flüchtlingswitwe eine angemessene Be [257]hausung? Diese Frage hatte sich Edith schon vor meinen Brüdern in tausend und einer Nacht gestellt. So wie es in den orientalischen Märchen urplötzlich wie durch ein Wunder eine Lösung für die heikelsten Probleme gibt, so fand meine Schwester einen Weg zu ihrem Märchenschloß. In der Gemarkung Elvershude bei Stubben, einen Katzensprung von Bokel entfernt, entdeckte sie eines Tages bei ihren Fahrten mit dem Pferdewagen über holpriges Kopfsteinpflaster ein Grundstück. Sie erkundigte sich nach dem Eigentümer. Es war ein Bauer aus Elvershude.Edith nahm ihr Herz in beide Hände und machte dem Grundstücksbesitzer einen Besuch. Ob das Grundstück, das gleich am Anfang der Elvershuder Straße liegt, verkäuflich sei, fragte sie ihn. Es war kurz nach der Währungsreform. Der Bauer sah Edith von oben bis unten an und sagte: "Diese Frage ist doch von Ihnen nicht ernst gemeint. Wissen Sie, was das Grundstück und ein Haus darauf zu bauen heuzutage kostet? Sie wollen mich wohl auf die Schippe nehmen. Was wollen Sie mit einem so großen Grundstück anfangen? Das ist ein Sandberg, auf dem nur wenig wächst." Edith hatte den Plan, am Dorfrand von Stubben auf der fraglichen Fläche eine Nebenerwerbssiedlung zu errichten und dort Gemüse anzubauen. "Ja, der Boden ist sandig", antwortete sie, "da muß ich Ihnen recht geben, und deswegen für die landwirtschaftliche Nutzung nur von geringem Wert." Vor diesem Gespräch hatte sie aber das Grundstück bereits eingehend begutachtet und dabei festgestellt, daß in dem dort angebauten Getreide sehr viel Distel wächst. Sie hatte sich bei dieser Beobachtung an ein Wort unseres Vaters erinnert: ‚Wo Distel wächst, da ist Lehm im Untergrund, da wächst auch was anderes.' Nach langem Hin und Her wurde sie mit dem Eigentümer handelseinig und kaufte das Grundstück. In den Verhandlungen mit der Gemeinde und mit der Niedersächsischen Landgesellschaft machte sie die Erfahrung, daß die Männer, mit denen sie zu tun bekam, sehr schnell ihre Initiative und Tatkraft erkannten und ihr halfen, wo es ihnen nur möglich war. Für die örtlichen Handwerker war es das erste Haus, das sie in [258] Stubben nach dem Kriege bauten. Sie setzten ihren Ehrgeiz daran, möglichst preiswert und gut zu arbeiten.Ursula erzählte Herrn Neynaber, daß sie und ihre Schwester ein Haus bauen. Sie könnten nicht länger der Familie Terjunk in Bokel zur Last fallen. Am nächsten Abend fuhr ihr Chef zu der Baustelle, um sie zu besichtigen. Wie er am nächsten Tage Ursula gegenüber bemerkte, habe er es den beiden Frauen zunächst nicht zugetraut, selbständig ein Haus zu bauen. Der Rohbau sei solide und fände seine Zustimmung. Er habe auf der Baustelle ein Handwaschbecken hinterlassen und von den dort anwesenden Handwerkern gehört, daß ihr Geld nicht mehr für die Einrichtung des Badezimmers ausreiche. Für kultivierte Frauen sei es unverzichtbar. Er werde die Rechnung des Klempnermeisters bezahlen. Meine Schwester könne den Kredit später in kleinen Monatsraten abzahlen. Die Rechnung für die Badezimmereinrichtung betrug 4.000,-- oder 5.000,- DM. Als das Haus fertig war, zogen meine Mutter, Ursula mit Rüdiger und Horst, Edith mit Sybille und Renate ein. Die Großfamilie reiste an, besichtigte es und schrieb Gereimtes und Ungereimtes in das neu angelegte Gästebuch. Es liegt vor mir, in Leder gebunden, und macht den Eindruck, als ob es eine neue Familientradition begründen sollte. Die ersten Eintragungen zeugen von der großen Leistung der Frauen unserer Familie, ihrem Lebenswillen und ihrem Durchsetzungsvermögen in einer von den Männern beherrschten Gesellschaft. Trotz dieses vielversprechenden Anfangs folgen dann viele leere Seiten. Die Zeiten waren erfüllt von Hektik, Wettbewerb und Tempo, so daß die Gäste nicht die Muße fanden, geistreiche Eintragungen zu machen. Sie unterblieben deswegen sehr bald. In den Jahren fünfzig und einundfünfzig war es in Flüchtlingskreisen noch etwas ganz Besonderes, eine Schicksalsgefährtin im eigenen Haus besuchen zu können. Davon legen zwei Eintragungen ein besonderes Zeugnis ab: Bewunderung nur können wir Euch zollen, das Haus war fertig ohne sie. Mög' dieses Buch von Freunden zeugen, von lieben Menschen, die Euch wohl gesonnen, mög' Euren Lebenswillen nichts mehr beugen, den ersten Kampf habt Ihr gewonnen. Werner, Ilse und Ute Oder einige Wochen später: Was Ihr für Euch und Eure Kinder habt errungen, Ilse und Walter Dahlweid Ursulas beide Söhne sind die einzigen Namensträger der Familie Dahlweid. Ihr Vater war zu der Zeit immer noch vermißt. Alle Bemühungen meiner Schwester, nähere Einzelheiten über Joachims Schicksal zu erfahren, blieben ohne Ergebnis. Ursula war die einzige, die regelmäßig ihr monatliches Gehalt bekam. Sie zahlte für sich und ihre beiden Kinder einen gewissen Betrag in die gemeinsame Haushaltskasse ein, die von meiner Mutter verwaltet wurde. Es ist bei einem Hausbau so wie in einem Omnibus. Auf der Haltestelle steigen viele Leute ein, sie drängeln und stoßen sich in zu engem Raum. Wenn der Omnibus erst eine gewisse Strecke gefahren ist, schaukelt sich alles wieder ein. Aus Schleswig-Holstein reiste Modeste v. Parpat, die Schwester von Joachim und Ilse Dahlweid, an. Sie liebt es, in die Herzen der Menschen zu sehen. In das Gästebuch schrieb sie: Ehe ich ins Walsertal zog, kam ich Euch besuchen, die einst vom Schicksal geschlagen nun wieder dessen Herr geworden sind. In unglaublich kurzer Zeit risset Ihr die Mauer der Not, die Euch Sonne und Licht nahm, die Euer Herz und Geist [260] abschnürte, ein und bautet Euch und Euren Kindern ein Haus, in dem wieder Stolz und Freiheit blühen. Mit unerhörtem Fleiß schürftet Ihr Tag und Nacht aus den Goldschätzen Eures Herzens die Kraft ans Licht, die jetzt den Rahmen Eures äußeren Daseins tragen und erhalten. Und wenn es Euch auch manchmal scheinen mag, alle Goldadern Eurer Herzen wären versiegt, weil der Alltagsstaub zu dick herauffällt, so weiß ich doch, daß Euer Vorrat in diesem Leben nicht verbraucht wird, und ich danke dem lieben Gott, daß er solche Menschen geschaffen hat und ich sie kenne.Eure Modeste, den 5. August 1951 Edith experimentierte gerne und stellte ihre Nebenerwerbssiedlung mehrmals um. Zunächst hatte sie einen intensiven Gemüse- und Erdbeeranbau betrieben. Schon sehr bald genügten ihr die dadurch erzielbaren Gewinne nicht mehr. Sie baute einen Hühnerstall und hielt Legehennen zur Eierproduktion. Als die Rentabilität dieses Betriebszweigs geringer wurde, baute sie an ihr Haus einen Blumenladen an. Mit einer kaum zu übertreffenden Energie setzte sie sich in den folgenden Jahren für die Entwicklung ihres Blumengeschäfts ein, dessen Umsatz von Jahr zu Jahr langsam anstieg. Edith erreichte ihr Ziel mit einem unermüdlichen Fleiß, mit großzügigen finanziellen Dispositionen und mit sicher kalkuliertem Risiko der Kreditaufnahme. Eine Kapitalverflechtung ihres Geschäfts mit ihrer Schwester Ursula oder mit den drei Brüdern hatte sie nie angestrebt. Sie wollte selbständig sein, so wie es viele Generationen vor ihr als Bauern waren. Ihr Herz gehörte den beiden Töchtern, den Kindern ihrer großen Liebe, deren Bild neben ihrem Bett hängt und dort wohl immer bleiben wird. |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|