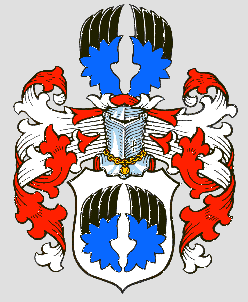
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Was Ilse auf der Flucht erlebte |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
"Ich ließ mich am 19. Januar 1945 mit einem Firmenauto bis Bromberg fahren. Der Chauffeur nahm die Hälfte meines Gepäcks zurück, denn Astrid war noch so klein, daß ich sie auf dem Arm tragen mußte. Außer ihr und Karin hatte ich nur einen Koffer und einen Rucksack. Ich stieg in einen Personenzug ein, der in Richtung Berlin fuhr. In Landsberg an der Warthe mußten wir umsteigen, denn meine Schwiegermutter hatte mir gesagt, wir würden uns für den Fall einer Flucht bei ihrer Schwester in Lebus treffen. Dort wohnten Tante Else und Onkel Karl Günther. Auf dem Bahnhof in Landsberg hatte ich mein Gepäck abgestellt und Karin gesagt, sie solle dort stehen bleiben, bis ich mich nach dem Anschlußzug erkundigt habe. In dem ungeheuren Durcheinander fand ich den Zug nach Lebus und setzte Astrid hinein. Dann lief ich zurück zur Karin, die treu und brav das Gepäck bewachte. Wir gingen so schnell wir konnten zu dem Zug zurück, in dem Astrid bitterlich weinend saß. Die Fahrt nach Lebus verlief planmäßig, nur meine neuen Stiefel machten mir zu schaffen. An genügend Essen und Trinken für die Kinder hatte ich nicht gedacht. Es reichte aber für die Bahnfahrt aus. In Lebus ging ich auf den Hacken vom Bahnhof bis zur Wohnung von Tante Else und Onkel Karl, denn meine Stiefel drückten so sehr, daß jeder Schritt schmerzte. Tante Else war sehr überrascht, als ich plötzlich mit den Kindern vor ihrer Wohnungstür stand und mich vorstellte, denn wir hatten uns vorher nicht per[230]sönlich kennengelernt. Sie nahm uns sehr gastfreundlich auf. Wir blieben fast zwei Wochen bei Günthers. Als die russischen Truppen an die Oder vorrückten, hieß es plötzlich, Frauen und Kinder sollten sofort Lebus räumen. Wir beratschlagten mit Günthers, wohin ich fahren solle. Ich hatte Werner in Dresden besucht, als er dort auf der Kriegsschule war. So fuhr ich mit den Kindern und meinem Gepäck nach Cottbus ab. Bevor wir hier ankamen, blieb der Zug lange Zeit auf der Strecke stehen. Wir hatten große Angst, die Russen könnten die Oder überschritten haben und bis hierhin vorgestoßen sein. Das war aber nicht der Fall. Der Zug fuhr nach Cottbus weiter, wo wir in eine andere Bahn nach Dresden umstiegen. Sie war mit Flüchtlingen und Militär so überfüllt, daß wir keinen Platz mehr fanden. Da setzten zwei Soldaten zuerst die beiden Kinder und dann mich durch das Fenster in ein Abteil hinein, das voller Menschen war. Es dauerte viele Stunden, bis wir Dresden erreichten. Vom Hauptbahnhof ging ich in das Hotel, das ich von meinem Besuch bei Werner kannte. Der Portier musterte mich von oben bis unten und fand wohl, daß mein Aufzug nicht standesgemäß war. Er gab mir dann aber doch ein Zimmer. Aus finanziellen Gründen konnte ich nicht allzu lange in diesem Hotel bleiben. Es war auch unmöglich, dort die Windeln für Astrid zu waschen. Da fiel mir ein, daß die Mutter eines Kameraden von Werner in Weißen Hirsch, einem Vorort von Dresden, wohnte. Gehst einfach hin und fragst sie, ob ich mit den Kindern bei ihr wohnen könne, dachte ich. Sie nahm mich auf, sagte mir aber nach ein paar Tagen, ich solle mich nach einem anderen Zimmer umsehen, denn sie könne mich nicht länger beherbergen. Eines Sonntags zog ich dann los, ging von Haus zu Haus und fragte, ob ich ein Zimmer bekommen könne. Dann kam ich an eine Haustür, an der man mich nicht gleich abwies. Es war eine Pfarrersfrau, die mich einlud, in ihre Wohnung zu kommen, und mir ihre Hilfe bei der weiteren Suche einer Unterkunft anbot. Sie rief ihre Schwiegertochter [231] an und fragte sie, ob ich mit zwei Kindern in eine vor kurzem in ihrem Hause frei gewordene Wohnung einziehen könne. Später sagte sie mir, daß sie den Brilliantring an meiner Hand gesehen, dadurch auf meine Herkunft geschlossen und mich als vertrauenswürdige Frau ihrer Schwiegertochter empfohlen hatte. Es dauerte nicht lange, bis sie zu uns kam und mich mit den Kindern abholte. Als wir die kleine Wohnung sahen, waren wir selig. Sie war möbliert und hatte zwei bezogene Betten. In der Küche waren sogar einige Eßvorräte. In meinem Gepäck hatte ich seltsamerweise eine Häkeldecke, die ich auf den Tisch legte. Es war richtig gemütlich. Die Freude über die Wohnung dauerte leider nicht lange. In der Nacht vom 12. zum 13. Februar, ich hatte die Kinder gerade schlafen gelegt, wurde Fliegeralarm gegeben. Ich schnappte ein kleines Lackköfferchen mit den wichtigsten Sachen, nahm meine beiden Kinder aus den Betten und lief so schnell wie ich konnte in den Keller. Draußen war es durch die Christbäume, die als Positionsmarkierungen von den einfliegenden angloamerikanischen Flugzeugen gesetzt worden waren, hell wie am Tag. Die Luft war erfüllt von dem Dröhnen der Bomber. Bei der ersten Angriffswelle war auch unsere Häuserzeile getroffen worden. Im Luftschutzkeller hatten sich Risse im Mauerwerk gebildet, durch die Rauch eindrang. Wir befürchteten zu ersticken. Einige alte Männer schlugen mit Spitzhacken ein großes Loch in die Wand zum danebenliegenden Keller. Wir krochen durch die Öffnung hindurch und wollten in diesem unbeschädigten Schutzraum den Morgen abwarten. Nach kurzer Zeit kam die Inhaberin meiner Wohnung und erkundigte sich, ob hier eine Frau Ilse Krüger mit zwei Kindern sei. Die Menschen kannten mich nicht, riefen aber meinen Namen. Ich meldete mich und ging zu der Zimmerinhaberin. Sie sagte, daß es furchtbar gewesen sei. Wir können deswegen nicht bei ihr bleiben. Sie habe einen Kinderwagen besorgt. In den setzten wir die Kinder hinein und trugen ihn auf die Straße. Dann gingen wir durch das brennende Dresden bis zu [232] einem Vorort, wo meine Wohnungsinhaberin uns zu einer Bekannten hinbrachte. Sie nahm uns bereitwillig auf. Wir zogen uns aus, um uns in die Betten zu legen. Da sagte sie, ich solle mich waschen. Ich habe die Kinder und mich schon vor dem Alarm gewaschen, entgegnete ich. Sie bat mich, in das Badezimmer zu gehen. Dort erkannte ich mich im Spiegel nicht wieder, denn Rauch und Mörtelstaub hatten mich pechschwarz gefärbt.
Als ich mich und die Kinder gewaschen hatte und wir auf der Bettkante saßen, ging es wieder los. Ohne Vorwarnung gab man dieses Mal gleich Vollalarm. Wir liefen in den Keller, der aber nicht so sicher war wie der andere. Wir waren jetzt in einer Villa. Wir hörten den brennenden Phosphor, die Flammen erzeugten ein Geräusch, als ob Wasser einen Sturzbach herunterplätschert. Wir sahen durch das Kellerfenster, wie sich die gequälte Natur gegen den Bombenhagel aufbäumte. Es regnete plötzlich in Strömen, ein Feuersturm brach los, die Bäume bogen sich und brachen um. Ich kniete neben meinen Kindern legte beide Arme über sie und dachte, wenn es passiere, sind wir alle drei tot, dann soll es eben so sein. Unser Haus zitterte, die Scheiben platzten, die Türen schlugen auf und zu. Die Menschen flehten zu Gott. Als alles vorbei war, gingen wir aus dem Haus hinaus. Vor der Eingangstür war ein großer Bombenkrater. Wir sollten alle zu einer Schule gehen, wo ein Sammellager eingerichtet sei, wurde von den Luftschutzwarten gesagt. Meine Wohnungsinhaberin ging fort, um einen anderen Unterschlupf für mich und die Kinder zu suchen. Das gelang ihr auch. Eine ganz einfache Frau stellte uns ihr Schlafzimmer zur Verfügung, in dem ich die Kinder in eine der Ehebetten und ich mich in das andere legte. Als wir uns erholt hatten, wurde mir klar, daß wir bei dieser armen Frau nicht bleiben könnten. Mir fiel die Adresse eines anderen Kriegskameraden von Werner in Niederbobritzsch ein, der in einem anderen Vorort von Dresden wohnte. Wir gingen durch die verwüstete Stadt dorthin, wo uns ein Zimmer zur Verfügung gestellt wurde, in dem ein gußeiserner [233] Ofen stand. Auf ihm konnte ich für die Kinder etwas kochen. Viel hatten wir nicht. Von dieser Wohnung aus schrieb ich an meine Mutter in Jüterbog und bat sie, zu mir nach Dresden zu kommen. Wie sich später herausstellte, war sie schon auf Grund einer früheren Nachricht von mir nach Dresden gekommen. Sie hatte die Luftangriffe ganz allein in einem Keller erlebt, in dem sich außer ihr nur ein Papagei befand. Wenn das Haus getroffen worden wäre, hätte kein Mensch gewußt, wo sie geblieben ist. Am 15. Februar suchte sie in dem noch brennenden Dresden die Straße, in der sich meine Wohnung befand und die ich ihr nach Jüterbog geschrieben hatte. Die Häuser waren aber alle zerstört. Sie schleppte sich durch das Trümmerfeld, um nach mir zu suchen. Was sie an diesen Tagen gesehen hatte, wäre so grauenvoll gewesen, daß sie darüber nicht sprechen wollte. Die toten Menschen wären nackend gewesen, da ihnen der Feuersturm die Kleider von Leibe gerissen habe. Als meine Mutter mich nicht fand, fuhr sie wieder nach Jüterbog zurück, wo sie meinen zweiten Brief vorfand. Daraufhin kam sie am 2. März zu mir. Bald darauf erhielt Werner von seinem Lazarett in Bückeburg Genesungsurlaub, den er in Niederbobritzsch verlebte. In diesem Durcheinander erhielt ich einen Brief von meiner Schwiegermutter. Es ist erstaunlich, was die Reichspost damals leistete. Du kannst ihn ablichten. Das Original mußt Du mir aber wieder zurückgeben. Es ist das wertvollste Stück meines Familienarchivs." Meine liebe Ilse, liebe kleine Karin und Astrid! Heute erfuhr ich von Jutta Deine Adresse (Tochter des in Stalingrad vermißten Onkel Gerhard Krüger). Die Sorgen um unsere Lieben nehmen kein Ende. Möge Euch alle der liebe Gott beschützen. Das Schicksal hat uns hart angepackt. Ob sich unsere Familie jemals wieder zusammenfinden wird? Am Sonnabend, den 19. Januar 1945, nachts um zwei Uhr fuhr ich von Altthorn mit drei Planwagen ab. In Schmolln gab uns der Ortsgruppenleiter den Befehl zurückzufahren. Nur die Polizei, die von uns Pferde und einen Wagen hatte, durfte weiterfahren. So kehrten wir wieder um. Ich legte mich im kal[234]ten Haus ohne mich auszuziehen ins Bett. Nach vier Stunden hieß es, aus Altthorn und Gurske würden sich alle absetzen, auch der Ortsgruppenleiter. Wenn ich jetzt nicht aufbräche, bliebe ich allein zurück. Wir rafften schnell unsere Sachen zusammen und fuhren zum zweiten Mal mit viel Weh im Herzen in die Kälte und Dunkelheit. Erst in Pensau holte ich die Altthorner ein. Bei Ea hielt ich nicht an, da ich vermutete, daß Feldts schon weg waren. Also ging es schweren Herzens bei ihr vorbei und weiter. Beim Gasthaus in Pensau hielten wir an. Lottchen Görz sagte, daß sie gehört habe, die Russen seien bereits im Anmarsch auf Bromberg. Wir wollten über diese Stadt nach Wirsitz und von dort weiter nach Großputz fahren. Wir wurden aber nicht mehr nach Bromberg hineingelassen, sondern gleich weiter in Richtung Schneidemühl geleitet. Ich trennte mich von den Altthornern, weil ich über Zempelburg und Konitz nach Berent wollte. Seitdem war ich mutterseelenallein mit Hertha, Wanda, Steffi und dem Schweizergehilfen, der kein Wort deutsch konnte. Es war zeitweise zum Verzweifeln. Dann kamen aber auch wieder bessere Tage. Als Schneesturm einsetzte, kamen wir mit unserem Treckwagen nicht weiter. Das war aber schon auf der Straße von Berent nach Großputz. Als ich zu Fuß weiterging, sprach mich wie von Gott geschickt der Nachfolger von Joachim an, begrüßte mich herzlich, ließ mich auf seinen Wagen aufsteigen und versprach mir, den Treck abzuholen. Ich war fast am Ende meiner Kräfte und freute mich auf ein warmes Bad und eine Nachtruhe im richtigen Bett. Großputz quoll über von Flüchtlingen und Militär. Ursula, die schwanger ist, entschloß sich, mit der Bahn zu fahren und nicht mit meinem Treck mitzukommen. Ach, wie schwer war die Entscheidung, mich von meiner ganzen Habe zu trennen. Am nächsten Tag ging's von Berent im Viehwaggon nach Westen. Alle Eisenteile waren mit einer dicken Eisschicht bedeckt. In Kolberg wurden wir ausgeladen, saßen auf dem Bahnhof fest und wußten nicht, wohin wir uns wenden sollten. Da stand uns der liebe Gott zur Seite und führte uns zu sehr netten, besorgten Menschen in eine Wohnung mit Küche. Schön warm ist es hier, [235] und Frau Marten betreut uns liebevoll. Ganz unverhofft trafen wir vor einigen paar Tagen Ea mit ihrem Treck. Die Freude darüber war überwältigend. Wir behielten sie einen Tag bei uns, konnten für sie waschen, kochen, Sybillchen und Renatchen betreuen. Ach, es war unfaßbar schön. Die Kinder hatten Durchfall und waren sehr elend. Als sie sich eine Zeitlang in unserer Wohnung betreuen ließen, war schon alles viel besser. Ilse, wie grausam ist es, nichts von unseren lieben Soldaten zu wissen, wo sie sind und wie es ihnen geht. Keiner kann ihnen helfen. Was wird nur aus allem werden? Ob Du Nachricht von Werner hast, wage ich gar nicht zu fragen. Ursula weiß nichts von Joachim. Die letzte Nachricht besagt, daß er von Prag aus an die Front versetzt worden ist. Werner und Hans-Joachim haben sich auch nicht bei Horst gemeldet. Wir wollen mit der Bahn zunächst zu ihm nach Parchim fahren und dann weiter zu Ursulas Schwägerin Susanne in Oldenburg. Gott allein kann noch helfen. Wie ist es möglich, daß so ein Leid über uns gekommen ist. Schreibe bitte an Horstchen, Fliegerhorst Parchim, NJG 3, Staffel 2, damit wir erfahren, wie es Dir und den Kindern geht. Seid herzlich gegrüßt von Eurer Mutti und Omi. "Werner bemühte sich beim Bürgermeister und Ortsgruppenleiter um eine andere Wohnung" denn unsere Unterbringung spottete jeder Beschreibung. Es ist hart, auf den guten Willen anderer Menschen angewiesen zu sein. Nach langem Hin und Her kamen wir mit einem Ehepaar Dietel in Kontakt. Ihr Sohn war gefallen. In ihrem Haus lebten die Schwiegertochter und eine Enkelin. In das Ausgedingehaus mit zwei Zimmern und einer Wohnküche durften wir einziehen. Frau Dietel gab uns manchmal Milch und Leinöl. Ich habe dort zum ersten Mal Pellkartoffeln mit Salz und Leinöl gegessen. Das schmeckte hervorragend. Während der Zeit, als wir bei Dietels in der Ölmühle wohnten, sahen wir kurz vor Kriegsende, wie ein langer Zug ausgemergelter Menschen die Straße an unserem Hause vorbei ging. Sie waren in olivgrüne Wolldecken gehüllt. Am Ende dieses [236] Zuges fuhren einige Ackerwagen, auf denen Menschen lagen. Eine Frau klopfte schüchtern an unser Küchenfenster und verlangte etwas zu essen. Meine Mutter gab ihr ein Stück Brot, das sie eiligst in ihrer Decke versteckte. Uns hat das sehr erschreckt. Wir hörten später, es seien Juden aus einem Konzentrationslager, die die Nacht in einer nahegelegenen Scheune zugebracht hatten und nun in Richtung Tschechoslowakei gebracht wurden. Wir beobachteten, wie das Wachpersonal die Menschen zu einer schnelleren Gangart mit ihren Gewehrkolben antrieb. Im Erzgebirge herrschte damals große Hungersnot. Als sich die Russen vom Osten immer mehr Dresden näherten, flohen viele Menschen westwärts, denn Gerüchte besagten, daß Hof bereits von den Amerikanern besetzt sei. Wir konnten aber nicht weiter fliehen, denn wir hatten außer einem Kinderwagen keine Fahrzeuge und hätten eins der beiden Kinder tragen müssen. Niederbobritzsch verfiel kurz vor dem Einmarsch der Russen in Panik, der auch wir erlagen. Meine Mutter, Dietels Schwiegertochter und Enkelin, meine beiden Kinder und ich gingen zu Fuß nach Annaberg im Erzgebirge, wo wir in einer Mühle Zuflucht fanden. Herr Dietel hatte uns einpfohlen, solange dort zu bleiben, bis sich die Lage in Niederbobritzsch geklärt habe. Wie richtig dieser Rat war, zeigte sich, als wir hörten, wie die Rote Armee in dem Vorort von Dresden wüte. In unserem Zufluchtsort fand sie uns glücklicherweise nicht. Nach acht Tagen gingen wir trotzdem nach Niederbobritzsch zurück. Das war ein beschwerlicher Fußmarsch, denn wir mußten unsere Kinderwagen steile Berge hoch schieben. Dazu war meine Mutter zu schwach. Ich schob den einen Kinderwagen einen Abhang hinauf, ging dann wieder zurück, den anderen zu holen. Die Straßenränder waren mit Sachen übersät, die Flüchtlinge weggeworfen hatten. Aus aufgeplatzten Koffern war der Inhalt herausgefallen, den wir, obwohl für uns sehr wertvoll, liegen lassen mußten. Unterwegs begegneten wir Russen, die auf bespannten Fahrzeugen saßen und aus gestohlenen Einkochgläsern aßen. Sie taten uns glücklicherweise nichts. [237] Unterwegs mußten wir zweimal im Freien übernachten. Als wir unsere Wohnung sahen, waren wir entsetzt. Sie glich einem Schlachtfeld. Die Russen hatten sie geplündert, in der Wohnküche Kaninchen gehalten, alle Schränke und Tische umgekippt. Nachts schliefen wir außerhalb der Ortschaft in einem Wasserhäusel. Jeder Bauernhof hatte dort ein solches kleines Gebäude, in dem das Quellwasser in einem Behälter gesammelt wird. Auf dem Dachboden, auf dem Stroh gelagert wurde, übernachteten wir Frauen und die Kinder. Das dauerte mehrere Wochen lang. Einmal drangen die Russen am Tage in unsere Wohnung ein. Ich konnte mich durch einen Hinterausgang retten. Meine Mutter wurde von ihnen bedrängt. An die Vorgänge in Niederbobritzsch möchte ich mich nicht erinnern. Da die Versorgungslage katastrophal war, kursierten immer wieder Gerüchte durch das Dorf, daß alle Flüchtlinge und Ausgebombten zwangsevakuiert werden sollen. Ich hatte große Sorge um unsere Zukunft. Da entschloß ich mich im September, mit geflüchteten Leuten aus Frankfurt an der Oder, die dort eine Senffabrik betrieben hatten, in deren Lastwagen mitzufahren, in der Hoffnung, bei Tante Else Günther in Lebus ein Dach über dem Kopf zu finden. Der lange, beschwerliche Weg führte uns nach Berlin. Hier trennte ich mich von den Frankfurtern und ging zu der Familie von Onkel Gerhard Krüger. Sie hatte alles behalten, ihr Haus war unzerstört. Dort übernachtete ich. Jutta und ich schliefen im gleichen Zimmer und erzählten fast die ganze Nacht über. Am nächsten Tag fuhr ich mit dem Zug in Richtung Frankfurt an der Oder. Unterwegs erlebte ich mehrere Kontrollen durch die Russen. Der Zug hielt öfter mitten auf der Strecke. Ich hatte Angst, aber es verlief alles glatt. In Frankfurt wartete ich im Bahnhof solange, bis es hell wurde. Ein Mann gesellte sich zu mir, der auch nach Lebus wollte. Mir war nicht wohl dabei, aber es war besser so, als allein unterwegs zu sein. Ich sah die Auswirkungen des Vormarsches der Roten Armee. Alte Linden lagen quer über die Straße, links und rechts waren noch die Unterstände zu sehen. [238] Das Getreide war noch nicht abgeerntet, da die Felder vermint seien, wie man mir sagte. Lebus war restlos zerstört. Tante Elses Haus bestand nur noch aus dem Keller, dessen Außenmauern durchbrochen waren. Durch die Öffnungen gelangte man in Laufgräben, die in den Garten führten. Ich kramte aus dem Keller zwei dickwandige Tassen, Kleiderbügel, Stickgarn heraus und nahm diese Habseligkeiten mit. Als das Garn trocken geworden war, zerfiel es leider. In Lebus fand ich eine zusammengezimmerte Behausung, in der eine Frau wohnte, die mir etwas zu trinken gab. Sie war als erste nach der Evakuierung wieder zurückgekehrt. Ich glaube, sie hatte sogar ein Kaninchen im Stall. Die Russen patrouillierten immer wieder die Straßen entlang. Irgendwann fuhr ich mit dem Zuge wieder nach Berlin zurück, traurig, daß ich nichts erreicht hatte, und froh, daß ich bei der Flucht aus Thorn nicht in Lebus geblieben war. In einem Viehwaggon kauerte ich auf dem Boden. Ein Russe verteilte an uns elendes Häuflein trockenes Brot. In Berlin mußte ich in einen Zug umsteigen, der zu meinem Entsetzen restlos überfüllt war. Mit fremder Hilfe wurde ich durch das Fenster ins Abteil gehoben, hing zwischen den Reisenden eingeklemmt, bis meine Füße den Boden ertasteten. Meine nächste Station war ein Dorf bei Jüterbog, wo meine Mutter, bevor sie nach Niederbobritzsch kam, Unterkunft gefunden hatte. Dort besuchte ich ihren jüngsten Bruder. Ich wurde liebevoll versorgt und ruhte mich von den Strapazen aus. Mit Lebensmitteln versehen trat ich dann die Reise nach Niederbobritzsch an. Den Sommer über mußten wir hungern, da die Versorgung der Bevölkerung vollständig zusammengebrochen war. Im Herbst wurde es etwas besser, denn ich ging auf die Felder Ähren und in die Wälder Beeren sammeln. Herr Dietel half mir, das Getreide auszudreschen. Ich ließ die kümmerliche Ernte mahlen und brachte das Mehl zum Bäcker. Dadurch hatten wir einen kleinen Brotvorrat. Von den Waldbeeren kochten wir Marmelade. Obwohl es keinen Zucker gab, schmeckte uns der Brot[239]aufstrich. Wie ich es fertig gebracht habe, die Kinder und uns beide Erwachsene vor dem Verhungern zu bewahren, weiß ich heute nicht mehr. Meine Mutter stand oft nachts auf und schüttelte Äpfel von den Bäumen. Wir hatten dann wenigstens für ein paar Tage Apfelbrei. Am 17. Oktober kam von Werner eine Karte, auf der er schrieb, daß er am Leben und als Holzfäller in Kranichstein bei Darmstadt tätig sei. Wenn er in vier Wochen nicht hier ist, dann gehe ich über die Zonengrenze, dachte ich. Das habe ich dann auch wahr gemacht. Am 17. November fuhr ich los, zunächst bis Nordhausen. Hinter dem Bahnhof standen Menschen, die miteinander berieten, wie sie am besten über die grüne Grenze gehen könnten. Ich fragte sie, ob ich mich anschließen könne. Das bejahte man, mit der Bemerkung, daß man auf mich keine Rücksicht nehmen würde, wenn ich unterwegs schlapp machte. Wir gingen zu Fuß los, stundenlang über frisch gepflügten Acker, stets die Ortschaften umgehend. Wir sahen die Lichter in den Dörfern und hörten russische Laute zu uns herüber schallen. Eine Frau aus unserer Gruppe brach plötzlich zusammen und blieb liegen. Wir kletterten durch Stacheldrahtzäune und gingen über Viehweiden, immer in dem Gedanken, nicht von russischen Wachposten entdeckt zu werden, die in den Ortschaften waren. Wir schlichen uns an einen Waldrand heran. Bald kamen wir auf eine Straße, auf der wir plötzlich einer Militärpatrouille gegenüberstanden. Im ersten Augenblick befürchteten wir, es seien Russen. Zum Glück hatten wir aber schon die Demarkationslinie überschritten. Die Spannung löste sich, als wir merkten, daß es Engländer waren. Die nahmen uns mit und gaben uns in ihrer Unterkunft heißen, mit Zucker gesüßten Tee. Das war für mich eine Erfrischung und Stärkung, die ich nicht mit Worten beschreiben kann. So etwas Gutes hatte ich schon seit vielen Wochen nicht genossen. Wir übernachteten in einer Schule. Am nächsten Morgen trennte ich mich von der Gruppe und zog allein mit dem Ziel Bebra weiter. Dort stieg ich in einen Zug, der nach Frankfurt am Main fuhr. [240] Der Hauptbahnhof von Frankfurt war vollständig zerstört. Es war kalt, ich fror, mußte aber die ganze Nacht über auf einen Anschlußzug warten. Hier sah ich zum ersten Mal in meinem Leben amerikanische Soldaten mit schwarzer Hautfarbe. Sehr früh am Morgen stieg ich in den Zug nach Wixhausen bei Darmstadt ein. Ich kannte die Adresse von Werner, der bei Frau Heck, der Mutter eines Kameraden von ihm, wohnte. Als ich mich dem Hause näherte, gab ich mich durch unseren Familienpfiff zu erkennen, in der Hoffnung, Werner würde aus dem Fenster herausschauen. Das war aber nicht der Fall, sondern Frau Heck öffnete mir die Haustür. Ich fragte sie:, Wohnt hier Herr Werner Krüger? Sie sagte: ‚Ja, aber er ist zu seiner Mutter nach Bokel gefahren.' Sie nahm mich in die Küche und wollte Frühstück machen. Da sackte ich am Tisch vor Erschöpfung zusammen. Sie legte mich auf ihr Bett. Die Enttäuschung darüber, daß ich Werner nicht angetroffen hatte, war so groß, daß ich trotz Müdigkeit lange Zeit nicht einschlafen konnte. Nachdem ich mich beruhigt hatte, sank ich in einen tiefen, langen Schlaf. Währenddessen hatte Frau Heck Essen zubereitet. Ich empfinde für die kräftige Milchsuppe und das nachfolgende Fleischgericht eine ebenso große Dankbarkeit wie für den Tee, den mir die Engländer gaben. In Werners Tagebuch las ich, daß er von Frau Heck die Anzüge ihres Sohnes bekommen habe, wodurch es ihm möglich geworden sei, mit Landmaschinenfabrikanten, mit denen er früher in geschäftlichen Beziehungen stand, wieder in Verbindung zu treten, daß in Goddelau bei Darmstadt ein Dortschmied dazu bereit sei, ihm die Werkstatt zu verpachten und daß er daran glaube, dort eine neue Existenz aufbauen zu können. Ich bemühte mich daraufhin beim Bürgermeister um eine Wohnung in Goddelau. Er wies mir zwei Zimmer zu, die ich mietete, noch ehe Werner zurück war. Mich beunruhigte sehr die Frage, wann er wieder in Wixhausen eintreffen würde, da ich meiner Mutter und den Kindern fest versprochen hatte, nach acht Tagen wieder in Niederbobritzsch zu sein. Werner kam rechtzeitig zurück und entschloß sich, mit mir in die sow[241]jetisch besetzte Zone zu fahren. Wir überstanden die Fahrt mit dem Zug trotz mehrfacher russischer Kontrollen recht gut und trafen wohlbehalten in Niederbobritzsch ein. Da Werner keine Einreisepapiere hatte, blieb er in unserer Wohnung, und ich machte die notwendigen Gänge zu den Behörden. Unsere Sachen, die ich inzwischen zusammengebettelt hatte, verpackten wir in den zwei Kinderwagen, die wir immer noch hatten. Besonders wertvoll war für uns das Getreide, das noch übrig geblieben war. Mit offiziellen Ausreisepapieren fuhren wir dann mit dem Güterzug aus Niederbobritzsch ab und kamen nach vier Tagen und Nächten in Wixhausen an. Frau Heck bewirtete uns wie ihre Kinder und Enkel, bis wir mit Sack und Pack nach Goddelau umzogen." |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|