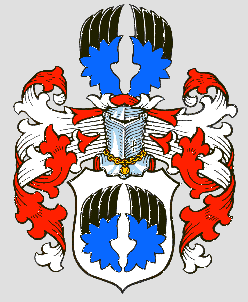
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Ediths langer Treck |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
"Wir fuhren mit zwei Kutschwagen, fünf Planwagen und vierzehn Pferden am 22. Januar 1945 von Pensau ab. In dem Landauer, in dem ich mit meinen Schwiegereltern und meinen beiden Kindern saß, und in den Ackerwagen hatten wir je eine Stallaterne als Licht- und Wärmequelle. Die Treckwagen waren mit Futter für die Pferde, Lebensmitteln, den wichtigsten Familiendokumenten und Wertsachen randvoll beladen. Kurz vor dem Aufbruch hatten wir noch geschlachtet. So waren wir mit Schinken, Speck, etwa hundert Einweckgläsern und sonstigen Vorräten gut versorgt. Fünf deutsche und polnische Familien wollten mit uns zusammen fliehen. Auch eine Ukrainerin war mit dabei. Achtunddreißig Kühe und über sechzig Kopf Jungvieh blieben in den Ställen zurück. Wir warfen den armen Tieren vor der Abfahrt noch reichlich Futter vor. Als unser Treck durch das Hoftor rollte, sahen wir uns nicht einmal mehr um. Wir wollten bei Fordon über die Weichselbrücke fahren. Das ging nicht, da sie schon zerstört war, als wir ankamen. So hofften wir, weiter stromabwärts einen günstigen Übergang über den zugefrorenen Strom zu finden. Trotz mehrfacher Versuche gelang es uns nicht, die aus der Weichselniederung steil ansteigende, durch Schneeverwehungen unpassierbare Straße nach Rentschkau hochzufahren. Die Wagen rutschten immer wieder herunter, und die Pferde konnten sie der Eisglätte wegen nicht bergauf ziehen. Auf der südwestlichen Seite der Weichsel hörten wir Artillerielärm. Die Russen standen bereits vor Bromberg. So entschlossen wir uns, nach Scharnau und von dort soweit stromabwärts zu fahren, bis wir nördlich der am weitesten vorgestoßenen russischen Truppen nach Westen entkommen können. Als unser Treck diesen Punkt erreicht [223] hatte, versuchten wir, nachts bei achtundzwanzig Grad Frost die Weichsel zu überqueren. Mein Schwiegervater ging zu Fuß voraus, um die Stärke des Eises zu prüfen und eine Stelle zu suchen, an der wir über den Damm fahren können. Als er zurück war, überlegten wir gemeinsam, welche Hilfsmittel wir benötigen und wie sich jeder einzelne zu verhalten habe. Da wir nicht wußten, ob die Dörfer auf der anderen Seite der Weichsel von russischem Militär besetzt waren, gingen wir vorsichtig vor. Die Pferde laut bei der Auffahrt auf den Deich anzutreiben, die Stallaternen aus den Wagen herauszunehmen, wurde verboten. Am schwierigsten war es, lautlos den Damm herunter zu fahren, denn die Wagen drohten, zu schnell zu rollen oder gar umzustürzen. Wir steckten Stangen in die Räder und ließen sie langsam den Deich hinunter rutschen. Mein Schwiegervater nahm die Pferde, die unseren Kutschwagen zogen, an die Zügel und führte uns sicher über das Eis. Die anderen Gespanne stampften in langer Kolonne hinter uns her. Auf der anderen Seite der Weichsel mußten wir wieder über den Damm hinüber. Da jedoch eine Auffahrt mit mäßiger Steigung in der Dunkelheit nicht zu finden war, wir aber keine Zeit verlieren wollten, spannten wir vor jeden Wagen sechs Pferde, die sich nur mit Mühe und Not auf dem hart gefrorenen, schneeglatten Boden auf den Beinen hielten. Als der Treck auf der Deichkrone stand, atmete ich erleichtert auf, denn nun hatten wir die erste Klippe glücklich überwunden. Wir fuhren bis zum Morgengrauen in nördlicher Richtung, legten eine Futterpause für die Pferde ein, zogen dann weiter und weiter, bis wir abends in Tuchel ankamen. Am nächsten Morgen hörten wir in der Gerüchteküche, daß die Russen ihren Vormarsch nach Nordwesten auf die Ostsee zu schnell fortsetzen. Wir trieben die Pferde zu höchstmöglichem Tempo an, mußten jedoch am Tage eine lange Futterpause einhalten. Wenn es Abend wurde, ging mein Schwiegervater oder ich voraus, Quartier für uns zu beschaffen. Das fanden wir in Pommern meistens auf Bauernhöfen, auf denen wir [224] stets mit viel Verständnis und Hilfsbereitschaft aufgenommen wurden. Auf den Rastplätzen fütterten wir zuerst die Pferde, dann wurden die Kinder und zuletzt die Erwachsenen versorgt. In der ersten Woche hatten wir genügend Hafer für unsere Pferde, später tauschten wir Futter für Nahrungsmittel ein. Die Russen näherten sich währenddessen weiter westlich der Ostsee. Es bestand für uns die Gefahr, im Kessel von Hinterpommern eingeschlossen zu werden. Deswegen wollten wir so schnell wie möglich Kolberg erreichen. In Pommern kamen wir gut voran, denn auf den Treckleitstellen, die gut organisiert waren und mittelalterlichen Heerlagern glichen, gab man uns Auskünfte, welche Straßen für uns offen und welche mit Flüchtlingen und mit Militär verstopft waren. Wir erhielten auf ihnen auch Ställe und Plätze zugewiesen, wo wir die Pferde füttern und Essen zubereiten konnten. In Kolberg traf ich wie durch ein Wunder zufällig meine Mutter, meine Schwester Ursula und Rüdiger. Sie waren von Berent mit einem Güterzug nach hierher gelangt. Wie sie es mir erzählten, habe die Fahrt zehn Tage gedauert. Wir zogen mit unserem Treck durch Kolberg und bemühten uns um ein Quartier, als ich plötzlich die Haustochter von Ursula sah. Sie sagte mir, daß Mutti und Ursula auch in Kolberg seien. Meine Freude darüber war unbeschreiblich groß. ‚Ihre Mutter und Ihre Schwester wohnen bei einer Architektenfrau namens Martens', sagte sie mir. Wir gingen hin, das Wiedersehen war bewegend für uns alle. Ich bekam mit meinen beiden Töchtern wieder regelmäßig warme Mahlzeiten, die von Mutti auf heimatliche Weise zubereitet wurden. In Kolberg mußten meine Mutter und meine Schwester vierzehn Tage bleiben, da die Russen bis kurz vor die Oderbrücke Altdamm bei Stettin vorgestoßen waren. Wir mußten uns aber bald wieder trennen, denn wir hatten uns entschlossen, so schnell wie möglich weiter in den Westen zu fahren. Nach einigen Tagen merkten wir, daß uns die Treckleitstellen in einem großen Kreis herumgeführt hatten, weil keine Oder[225]brücke passierbar war. Die Russen wurden dann aber siebzehn Kilometer von der einzigen Brücke zurückgeschlagen, auf der wir die Oder überqueren konnten. Westlich dieses Flusses wurde unser Treck von der Roten Armee nicht mehr bedroht. Wir zogen durch Vorpommern und Mecklenburg. Von Mutti hatte ich in Kolberg erfahren, daß Du auf dem Fliegerhorst Parchim seist. Ich wollte Dich dort unbedingt treffen. Das gelang mir nicht. Als ich bei der Hauptwache gegen elf Uhr anrief, sagte man mir, Du seist vor zwei Stunden mit Deiner Staffel in die Lüneburger Heide verlegt worden. Enttäuscht zogen wir in der endlosen Flüchtlingskolonne weiter nach Westen. Inzwischen hatten sich uns an die vierzig Wagen aus der Thorner Niederung angeschlossen. Von unseren vierzehn Pferden waren sieben Stuten tragend. Bald hinter Parchim begannen sie zu fohlen. Eine nach der anderen verendete dabei, da sie gleich wieder ins Geschirr mußten. Manche fohlten auch nachts in den Ställen der Treckleitstellen und krepierten dabei vor Erschöpfung. In Mecklenburg wurden wir auf den großen Gütern wie die Zigeuner behandelt, die man so schnell wie möglich los werden wollte. ‚Seht zu, wo Ihr unterkommt. Wir haben keinen Platz', wurde mir oft mit barschem Ton gesagt, wenn ich in einem Gutshaus anklopfte und um Quartier bat. Es war widerlich, wie wir dort behandelt wurden. Eines Tages erkrankte Renate. Sie hatte eine doppelseitige Lungenentzündung, bekam hohes Fieber und wurde immer apathischer. Bei Schneesturm und starkem Frost fuhr ich, das Kind in den Armen, weiter, bis wir bei Schnackenburg die Elbe überquerten und schließlich in Soltau ankamen. Hier gab Renate wieder die ersten Lebenszeichen von sich, guckte plötzlich aus dem Fenster unseres Landauers und sah spielende Kinder auf der Straße. Ihre ersten Worte nach mehreren Wochen waren: 'Mami, da Kinner.' Das war für mich das größte Geschenk, das sie mir machen konnte. Auch Sybille war unterwegs erkrankt. Sie hatte entsetzlichen Durchfall, saß dauernd auf dem Töpfchen, machte aber nur weißen Schaum. Das begann schon bald hinter Kolberg. [226] Von Soltau wurden wir nach Munsterlager weitergeleitet. Als ich durch das Gelände des Truppenübungsplatzes irrte, tat sich in der ersten Etage eines großen, roten Backsteinhauses ein Fenster auf. Eine Frau rief herunter, wen ich suche. ‚Quartier für viele Erwachsene und Kinder', rief ich hinauf. ‚Gehen Sie und holen Sie Ihre Leute. Ich erwarte sie in meiner Wohnung', war die Antwort. Als wir dort ankamen, fanden wir eine bereits gedeckte, große Tafel vor mit allen nur denkbaren Köstlichkeiten, mit Brot, frischer Butter und Wurst. Vorweg gab es eine Gulaschsuppe. In die Badewanne hatte unsere Gastgeberin bereits warmes Wasser eingelassen. Hier badeten die Kinder zum ersten Mal seit vielen Wochen. Frau Giese bereitete uns den Himmel auf Erden. Der Höhepunkt war: Wir durften alle in weiß bezogenen Betten schlafen. Das Haus unserer menschenfreundlichen Frau war wohl eine Dienstwohnung der Wehrmacht, denn sie erzählte uns, ihr Mann sei Soldat in Norwegen. Es war inzwischen Frühling geworden. Wir schöpften wieder Hoffnung. Über Rotenburg und Bremervörde ging unsere Fahrt weiter. Am 17. März kamen wir in Beverstedt an. Die Osterglocken und die Tulpenbäume blühten bereits. Von der Treckleitstelle wurden uns die endgültigen Quartiere zugewiesen. Ein Herr kam auf mich zu, musterte meine Familie und sagte: 'Sie haben kleine Kinder. Ich werde Sie nach Bokel schicken. Dort ist der Bahnhof Stubben ganz in der Nähe. Von dem aus können Ihre Kinder zur höheren Schule fahren.' Ich fühlte mich von so großem Weitblick überfordert, sah ihn entsetzt an und fragte, wozu wir wohl jemals einen Zug benötigen würden. 'Na, Sie werden schon sehen', gab er zur Antwort. Meine Schwiegereltern bezogen eine Wohnung in der ersten Etage des Wohnhauses, das dem Mühlenbesitzer in Bokel gehörte. Ich zog mit den beiden Kindern in ein kleines, unmittelbar neben der Mühle gelegenes Haus ein. Unsere sieben Pferde, die die Flucht überlebt hatten, wurden in den nächsten Tagen bei verschiedenen Bauern in Bokel und Umgebung untergestellt. Am nächsten Tag kam deutsches Militär und requi[227]rierte sie. Zugegeben: Sie haben uns einen anständigen Preis bezahlt. Am nächsten Tag, als Sybille das Haus und das Zimmer, in dem wir wohnten, genaustens in Augenschein genommen hatte, holte sie ihren kleinen Kinderkoffer vor, packte ihre Puppensachen ein und sagte zu mir: 'Mutti, spann die Pferde an. In dieser Bude bleib ich nicht.' Mir blieb nichts anderes übrig, als mich um ein neues Quartier zu bemühen. In dem Zimmer im Hause des Sägereibesitzers, das man uns zuwies, kamen wir vom Regen unter die Traufe. Mein Schwiegervater wurde nach den ersten Tagen unseres Aufenthalts in Bokel auf der Straße angehalten und auf plattdeutsch gefragt: ‚Sünd Sei een Graf?' ‚Nee, warüm fragt Sei meck dat?' entgegenete er. ‚Weil Sei jeden Moin blanke Stebel hett un weil Sei daher koomt, wo et veele Grafen un Barone giwt.' In Kolberg hatten meine Mutter und Ursula gesagt, daß sie hofften, in Oldenburg bei Susanne Drewke, der Schwester von Joachim Dahlweid, eine vorläufige Bleibe zu finden. Ich schrieb dorthin eine Postkarte und erhielt umgehend die Antwort, daß Mutti, Ursula und Rüdiger dort gut angekommen seien und daß meine Schwester voraussichtlich noch im April die Geburt eines Kindes erwarte. Sie und meine Mutter wären sehr froh darüber, wenn sie in meiner Nähe eine Unterkunft bekämen. Ich bemühte mich daraufhin eine ganze Woche lang beim hiesigen Bürgermeister, eine Wohnung für sie zu finden. Die bevorstehende Geburt zu verheimlichen, wäre zwecklos gewesen. Die Wohnung mußte sechs Personen und dem Neugeborenen ausreichend Platz bieten. Da Bokel und die umliegenden Dörfer ohnehin mit Flüchtlingen bis unter die Dachfirste vollgestopft waren, stand der Bürgermeister vor einem unlösbaren Problem. Er wollte, wofür ich Verständnis hatte, eine Zwangseinweisung vermeiden und schickte mich von Haus zu Haus. Eines Tages, als ich wieder einmal bei ihm vorsprach, sagte er, ich solle zu Frau Terjunk gehen. Ihr Mann sei noch in der Kriegsgefangenschaft und ihr Einfamilienhaus würde bei gutem Willen ausreichend Platz für uns bieten. Ich ging mit wenig [228] Hoffnung zu dem vom Bürgermeister benannten Haus und traf Frau Terjunk an der Gartenpforte. Mein Anliegen war eine Zumutung, wie man sie sich nicht größer vorstellen kann. Ich rückte zögernd mit ihm heraus und sagte, meine Schwester würde bald die Geburt eines Kindes erwarten. ‚Seien Sie alle und besonders Ihre Schwester herzlich willkommen in meinem Hause. Bitte, teilen Sie das sofort Ihrer Schwester mit, damit wir nicht unnötig Zeit verlieren.‘ Mir liefen die Tränen über das Gesicht. Mich bestürmten die Gedanken: Verlorene Heimat, Niederung, Bauernstolz verlaß mich nicht, ich bin keine Bettlerin, Kopf hoch, hatte Papa in seinem letzten Brief geschrieben, jetzt nur nicht schwach werden. ‚Weinen Sie nicht', sagte Frau Terjunk, ‚oder besser, weinen Sie sich ruhig aus.' Vielen Dank und entschuldigen Sie schon meine Tränen, sagte ich zu ihr, lief zurück in meine dürftige Behausung, von wo aus ich die nötigen Vorbereitungen für den Umzug meiner Familie aus Oldenburg traf. Das einzige Pferd, das mir verblieben war, spannte ich an und fuhr mit meinem Schwiegervater zusammen über Hagen an die Weser, holte dort Mutti, Ursula und Rüdiger mit ihrem armseligen Gepäck ab. Seitdem wohnen wir im Hause Terjunk in Bokel. Gleich in den ersten Tagen hatten wir sehr unter den englischen Tieffliegern zu leiden. Die Helden veranstalteten regelrechte Treibjagden auf alles, was sich bewegte. Ein Bombergeschwader überflog Bokel und warf eine Luftmine in der Nähe unserer neuen Behausung ab. Als in den ersten Maitagen bei meiner Schwester die Wehen begannen, versuchten wir einen Arzt oder eine Hebamme zu finden, die bereit waren, Geburtshilfe zu leisten. Wo wir auch vorsprachen, bekamen wir die gleiche Antwort, daß die Tiefflieger überall seien und es glatter Selbstmord wäre, sich auf die Straße zu wagen. Meine Mutter hatte die größten Erfahrungen von uns, denn sie hatte selber fünf Kinder in unserem Elternhaus in Altthorn bekommen. Sie half meiner Schwester so gut sie es konnte und legte den neugeborenen Jungen, ohne die Nabelschnur abzutrennen, neben Ursula auf das Bett. [229] |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|