![]() HEIM@THORN
HEIM@THORN
![]() Editorial - Inhalt
Editorial - Inhalt
![]() Die Thorner Stadtniederung - Inhalt
Die Thorner Stadtniederung - Inhalt
![]() Das Buch- Inhalt
Das Buch- Inhalt
![]() Die Quelltexte - Inhalt
Die Quelltexte - Inhalt
![]() Der Anhang - Inhalt
Der Anhang - Inhalt
![]() Die Links
Die Links
![]() Mein Thorn
Mein Thorn
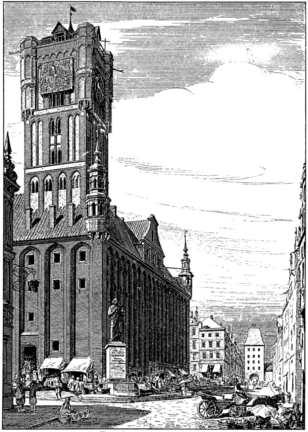
|
Arthur SemrauKatalog der Geschlechter der Schöffenbank und des Ratsstuhls in der Altstadt Thorn 1233-1602.Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn 46. Heft, S. 1-115, Thorn 1938 |
|||||||||||||
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer, z.B.: [23], bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang im Original. |
|
|||||||||||||
|
|
Ackerbaum. | |||||||||||||
|
[24] Andreas, zuvor Bürgermeister in Graudenz, erhielt 1599 das Bürgerrecht; 1599-1617 Schöffe. Vgl.Frölich, Geschichte des Graudenzer Kreises2 I 133, wo er als präsidierender Bürgermeister unter dem Jahre 1598 genannt ist. |
||||||||||||||
|
|
Aigner. | |||||||||||||
|
(Aigener, Eigner, Egner). Georg, 1550-1552, wird 1553 Ratm., 1557 und 1562 Richter. † 1566. |
||||||||||||||
|
|
Allen, von | |||||||||||||
|
(v. Allin, de Allen). Im Index zum ältesten Schöffenbuch wird Allen Kr. Hamm Prov. Westfalen als Herkunftsort angegeben.
Ein Herman de Allen zahlt etwa 1330 zusammen mit Henricus Monetarius in der Neustadt 1 f. Zins. Beide wohl Altstädter. ZWG. 7. Heft, S. 124. Gotko de Allen aus Thorn wird 1383 in einem Eintrage des Lemberger Stadtbuches genannt. Ihm steht eine Summe von 36 m zu. Pomniki dziejowe Lwowa Tom. I Nr. 83. Testament des Ratmannes Gottko von Allen 1390 Freitag vor dem [25] Drei-Königstage: er stiftet eine ewige Messe für sich, seine Vorfahren und Nachkommen (Mitt. 13.. Heft, S. 15 f.). 1389 ist also fälschlich als Todesjahr angegeben. Girke v. Allen und sein Halbbruder Gerhard werden 1416 genannt. Girke v. A. war ein Sohn der †Grithe Komnigynne (Nr. 1218 und 1219). Tileman v. Allen sein Vetter (Nr. 1119). Siehe 13. 1417 begleitet er mit anderen, darunter auch Ewirth Allen, den Großkomtur auf dem Ritt nach Graudenz (Mitt. 13, S. 30) 1411 wurde beschlossen, 2 Herren zu Hauptleuten zu wählen, einen aus dem Rat, den anderen aus der Bank. Gekoren wurden Andreas Kordelitz und Gerke von Allen (ebd. (S. 43). Der erste war Ratmann, der zweite Schöffe. 1428 war er einer der Abgesandten an den Bischof in Culmsee wegen des Freibrotmarktes (ebd. S. 58). Girke v. Allen wird hier sein Vetter genannt. 1417, 1419 Einzieher des Wächterlohns (Mitt. 13. Heft). 1463 in den aus 6 Personen bestehenden Kriegsrat gewählt (Mitt. 13, S. 100). 1461 wird er zum Hauptmann von Schwetz ernannt (Mitt. 13, S. 96). [26]Zuerst genannt 1474: Bertram v. A., Bürgermeisters Sohn, soll, weil er auf dem Kompenhause gescholten hat, ins Kämmerchen gehen, wird aber auf Bitten seiner Bekannten herausgelassen (Mitt. 13, S. 117). Daraus geht hervor, daß er Tilmanns II. v. A. Sohn ist. 1475 Bertram v. Allen wird wegen Handels auf dem Kompenhause mit dem Kämmerchen gestraft, aber auf Bitten, u.a. seiner Hausfrau Briline (=Brilinne, d.i. geb. Brilon, Brelon), herausgelassen (Mitt. 13, S. 119). Wir notierten früher Ehefrau Barbara Kordelitz, Tochter des Hermann Kordelitz (ohne Angabe der Quelle), können daher das Verhältnis der beiden Angaben zueinander nicht nachprüfen. 1503 wurde er auf der Tagfahrt in Marienburg krank und nach Thorn zurückgebracht (Mitt. 13, S. 138). Außerdem: Girco (Gerco) de Allen v. 1317 und c. 1320 (Mitt. 39, S. 163). 1400 wird Christian de Allen als einer der 3 sigillatores cerae genannt (Mitt. 13, S. 25). 1413 Hermann v. A. Einzieher des Wächterlohns (Mitteilungen 13, S. 46). 1475 Berthold v. A. Landschöffe (Mitt. 13, S. 117). 1510 Lucas v. A. ein Thorner, Hauptmann auf Roggenhausen und Briske (Mitt. 13, S. 142). Engel führt ihn auf Grund einer Urk. 1511 als Hauptmann von Roggenhausen (Mitt. 10, S.1) an. |
||||||||||||||
|
|
Beutel | |||||||||||||
|
[29] (Bewtel, Bewtil). Aus Schlesien. Johann, 1490 – 1493[Schöffe], wird 1494 Ratm., 1498 Richter, 1503, 1506, 1509 Bgmstr. (Mitt. 13, S. 138 u. 139), † 1510. Ehefr. Barbara von Allen. 1504 nach Prätorius (S. 30) in den Ritterstand erhoben. – 1507 verkaufte Alexander v. Heyden seine Anteil in Niederbriesen an Johann Beutel für 600 Mark und die Witwe Barbara Beutel denselben Anteil 1525 für 550 Mark an Christian Stroband (Maerker S. 208 f., Mitt. 13. Heft, S. 169 – 170, Toeppen, Thorner Stadtchronik). Die Witwe wird 1525 bei dem Rate wegen Lieferung von Eisen, Stahl, Hering und Wachs belangt (Mitt. 13, S. 157). 1528 wird sie unter den Getreidekaufleuten genannt (ebd. S. 168). Vgl. auch Prätorius S. 30. |
||||||||||||||
|
|
Gese | |||||||||||||
|
[40] (Geze). Vielleicht = Gise, Geise. Conrad, 1307/08 Schöffe. |
||||||||||||||
|
|
Gise | |||||||||||||
|
(Gisze). Wie das Wappen (Thorner Wappenbuch Nr. 96) beweist, entstammt der Thorner Träger dieses Namens dem bekannten Danziger Stadtgeschlechte. Vgl. Löschin, Die Bürgermeister etc. S. 20. Alexander, 1601, wird 1602 Ratm., † 1606. In Prätorius Ehrent. S. 42 irrtümlich: Andreas. Als Familienname zuerst: Niclos Giese von Strosberg 1411 und 1412 (Nr. 900 u. 937). |
||||||||||||||
|
|
Kochanski | |||||||||||||
|
[56] Der ursprüngliche Name des, Schöffen Hans K. war ursprünglich Schefer. Die Kürbücher nennen als 1559 gekornen Schöffen Hans Schefer, als 1564 gekornen Schöffen Hans Kochanski. So wird er bereits in einer Urkunde d. d. 1562 genannt. An der Identität beider darf nicht gezweifelt werden, wenn man berücksichtigt, daß Kochanski z.B. im Schöffenverzeichnis des Jahres 1565 zwischen Hans Fleischman (gekoren 1558) und Michel Siwert (gekoren 1560) verzeichnet ist, also an der Stelle, wo der 1559 gekorne Schefer stehen muß. Kochanski führte das Wappen Ogończyk (wie es bei Ledebur s. v. beschrieben ist, also mit der Abweichung von der Zeichnung bei Niesiecki, daß die Frauenarme einen halben silbernen Ring halten). Wie indessen der Schöffe K. mit der Familie Kochański (Herb Ogończyk) zusammenhängt, konnten wir nicht ergründen. - 1549 (Dezember 11) verpachtet der Rat das Gut Lubiani bei Korit dem Hans Scheffer auf 15 Jahre. 1559 zum altst. Schöffen gekoren, wird er als solcher in den Verzeichn. bis 1570 incl. genannt. Im Verz. des Jahres 1571 ist er wohl nur aus Versehen nicht genannt, denn es fehlt ein Schöffe; 1572 bat er sich los. Er starb 1575. Ehefrau Dorothea Knoff, Witwe des altst. Schöffen Wolf Bolze. Eine Tochter des Hans Kochanski, Catharina, war Ehefrau des Jakob Koie, † 1627 (vgl. Koie Nr. 6). Deshalb hing das Wappen der Kochanski in der Marienkirche neben dem der Koie. Thorner Wappenbuch Nr. 82 (das Blatt fehlt). - Über den neust. Schöffen Jakob Schefer, † 1606, s. Zeitschr. Marienw. 31, S. 90; Mitt. 199 S. 53 und 49. |
||||||||||||||
|
|
Koie | |||||||||||||
|
[56] (Koye, Coye). Der unter 1) genannte Benedict K., Kürschner, gebürtig aus Züllichau in Schlesien, überreicht hier 1471 (28. Aug.) ein Zeugnis der Zeche und erwirbt das Bürgerrecht. Er heiratet Katharina, die Tochter des 1471 %dagger; Bürgermeisters Conrad Teudenkus, des letzten dieses Namens. "Wegen seiner rittermessigen Thatten undt seiner Kinder Wohluerhaltnusz" wird er von Kaiser Maximilian I. mit dem Wappen der Teudenkus begabt und in den Adelstand erhoben. Der Wappenbrief ging verloren. Der Adel wurde durch Rudolf II. und den polnischen König Stephan bestätigt. Die zweite Bestätigung d. d. Bromberg 1577, 11. Febr., ist abgedruckt bei Niesiecki V S. 151 f. Vgl. Daniel Pruß, Genealogie der Koie, Thorn 1630 (Handschrift im Thorner Stadtarchiv).
|
||||||||||||||
|
|
Colberg | |||||||||||||
|
[57] (Kollenberg, Collinberg). Aus Kolberg in Pommern. Ditmar 1426. Zuerst genannt 1391 (Nr. 317). 1424 kauft Johan Rubyt seinem Schwager Ditmar Colberg das Vorwerk Merkaw ab (Nr. 1708). Siehe unter Stormer. Herman Kolberg zuerst genannt 1391 (Nr. 322). Nach einem Briefe d. d. Colberg 4. Ap. 1413 des Rats von Colberg will die Mitbürgerin Girdrud Langhe das Erbe nach ihrem † Bruder Herman Colberg in Thorn erheben (Nr. 979). - Ein anderer Herman Colberg, 1422 (Nr. 1613) und 1425 (Nr. 1839). |
||||||||||||||
|
|
Koppernik | |||||||||||||
|
[58] (Koppernig, Koppernigk, Koppernick). Nach dem Heimatort Köppernig bei Neiße. Über das Wappen siehe Mitt. 3, S. 63 f. und 10, S. 5. Niclas, 1465 – 1483. Zuerst Koppirnik und seine Ehefrau, deren erster Ehemann Mathias war, 1400 (Nr. 538). 1422 macht Margritte Koppirnickyinne in Vollmacht ihres Mannes Petir Koppirnick von Frankenstein Teilung mit Hans koppesmede (Nr. 1630). [59] Da Koppernik ein Herkunftsname ist, ist Verwandtschaft nicht nachzuweisen. Der oben genannte Niclas ist der Vater des Astronomen Nicolaus Coppernicus. Vgl. georg Bender, Heimat und Volkstum der Familie Koppernigk (Coppernicus) S. 12 f. und 36. |
||||||||||||||
|
|
Kruger | |||||||||||||
|
[61] (Krüger, Kriger, Krieger). Der unter 1 genannte Heinrich K. ist nach Prätorius (S.27) aus Köln am Rhein gebürtig, wanderte 1470 in Thorn ein (Mitt. 27, S.3). Thorner Wappenbuch Nr. 76.
1480 richteten Henrich Kruger und Joh. Rackendorf den Altar Fabiani, Sebastiani in S. Johann auf ihre Kosten auf (Mitt. 13, S. 126) Über die Verunglimpfung seines Wappens durch Frantz Francke) Fengelheim i. J. 1497 siehe Mitt. 13, S. 136. Nach Prätorius S. 28 war er Erbherr auf Slawkowo, Gostkowo, Vogelsang, Konczewicz, Bruchnowo, Zakrzewo, Brzezowo (sic!), Preuß.-Lanke, Niederbriesen und hatte das Lebtagsrecht auf Rogowo und Rogowko."Tochter Christina, Ehem. Georg Giese (Mitt. 27, S. 3). 1539 kaufte er einen Teil des Gutes Vogelsang, 1541 einen weiteren (Maerker S. 237; vgl. Mitt. 13, S. 181). Bei Prätorius S. 37 steht irrtümlich Michael. [62] |
||||||||||||||
|
|
Lichtfuß | |||||||||||||
|
[64] Aus Stargard in Pommern; vgl. Prätorius S. 42. Siehe Freytag, Die Familie Lichtfuß in Mitt. d. C.-V. 27. Heft, S. 4 f., daselbst Stammtafel S. 8-9. Thorner Wappenbuch Nr. 98. Aegidius, 1600 [Schöffe], wird 1601 Ratmann., † 1622. Ehefr. Elisabeth Stroband. Grabstein in der Marienkirche (Siehe Mitteil. 7. Heft, S. 13). Grabstein seines Bruders, des Ratmannes Friedrich Lichtfuß, † 1656, auch in der Marienkirche (Mitt. 7. Heft, S. 20). |
||||||||||||||
|
|
Peckau | |||||||||||||
|
[64] (Peckaw, Peckow, Peccaw, Peckauw, Peccauwe, Peccawge). Thorner Wappenbuch Nr. 69.
Johann Peckau 1460 als einer der 3 Bürgen für die Kirchengeräte von S. Johann genannt (Mitt. 13, S. 93). Wohl der unter 3 genannte Johann I. 1530 kam das Gut Vogelsang an Herman Pecken (=Peckau) (Mitt. 13, S. 171). Es gehörte ihm noch 1531 (Maerker S, 237). [Eine Peckauin war Ehefrau von Heinrich Krüger IV.] |
||||||||||||||
|
|
Snellenberg | |||||||||||||
|
[92] (Snellenbergk). Heinrich, 1475-1477, wird 1479 Ratm., 1481 Richter, † 1513. (Bei Prätorius steht irrtümlich Schellenberger. 1490 wurde vom Rate der Stadt Thorn die Walkmühle zu Leibitsch nebst 2 Hufen Land und einem Morgen Wiesen gegen 24 Mark Jahreszins dem Ratmann Schnellenberg zugeteilt mit der gleichzeitigen Erlaubnis, eine Schneide-, Kupfer- und Stampfmühle zu errichten (Maercker S. 340). [Ein Henr. Henrici Snellenberg studierte in Krakau 1491, Köln (Immatrikulation 12.8.1498), Ingolstadt 1501, Frankfurt 1507 und war ermländischer Canonicus von 1499-1539.] |
||||||||||||||
|
|
Tenk | |||||||||||||
|
[97] (Senck, Denck). ). Thorner Wappenbuch Nr. 90. Zuerst 1534 Michael Leonhard Tenck (Mitt. 13, S. 178).
[Einer der Teilnehmer des Turniers von 1583!] |
||||||||||||||
|
|
Teschner | |||||||||||||
|
[97] (Tesschner, Teschener). Der Name (nach dem Handwerk) tritt im ältesten Schöffenb. 1363-1428 nicht auf. Früher z. B. in Lemberg: 1384 Niczko Teschener, Schmied. Pomniki dziejowe Lwowa (Tom I).
|
||||||||||||||
|
|
Watzenrode | |||||||||||||
|
[100] (Waczenrode, Waczinrode, Waczelrode, Waczilrode, Walsenrode, Wetczelrode). Nach Benders Vermutung ist der Familienname auf den Ort Watzerat Kr. Prüm in der Eifel zurückzuführen (Mitt. 3, S. 64). [101] In einem Akziseregister von 1310 f., das nur in alter Abschrift erhalten ist, werden die Waczinrode fratres genannt (ebd.). Da aber in den Zinsreg. von c. 1317 und c. 1320 der Name nicht vorkommt (Mitt. 39. Heft), muß es sehr fraglich erscheinen, ob die 1369 auftauchenden Träger dieses Namens eine unmittelbare Fortsetzung jenes Geschlechts darstellen. Es werden in diesem Jahre genannt Johannes und Albrecht W. (Nr. 13), 1370 Fredrich und Jo. W. (Nr. 16), 1375 Fredrich, Johannes und Albrecht W. (Nr. 34), offenbar 3 Brüfer. 1376 war Johannes schon verstorben. Fridericus, Albertus und die minorennen Kinder des Johannes (Mitt. 3, S. 64).
Der in dem Eintrag Nr. 1466 genannte Albrecht muß ein Seitenverwandter (Freund) Friedrichs II. sein. Schwierig ist die Auseinanderhaltung der Albrecht. 1403-1404 wird Albrecht II. als Schöffe genannt. Wir können ihn nicht weiter verfolgen. 1423-1428 tritt Albrecht III. als Schöffe auf. 1422 wird Meister Cesarius (Zarias W.) Watczenrode mit seinem Bruder Olbrecht genannt (Nr. 1722; vergleiche Nr. 1729), 1424 der Vater beider als der ursprüngliche Besitzer eines Hauses am Ringe (Nr. 1733).
Außerdem kommt der Olbrecht W. 1424 als Bruder des Tilman W. vor (Nr. 1582), 1427 die 3 Gebrüder Olbrecht, Tilman und Lucas W. (Nr. 1947). [102] Der Zeit nach müßte Albrecht III., Schöffe 1423-1428, der Bruder des Cesarius sein. Albrecht als Bruder des Tilman und Lucas werden noch 1435 und 1440 genannt (Mitt. 3, S. 66). Wer nun der Vater dieser 3 Brüder war, bleibt unentschieden. Der Tidemannus W., den die überlieferte Stammtafel aus dem 18. Jahrhundert nennt (Mitt. 3, S. 73), ist sonst nicht nachgewiesen. Bender nimmt an, daß der Schöffe Albrecht (1377-1399) ihr Vater war. Dafür haben wir keinen Anhalt finden können. Wir suchen die 3 Brüder unter den unmündigen Kindern des Johannes W. Thorner Wappenbuch Nr. 41.
Als Berichtsmann 1399 Okt. 16 (Urk d. Bist. Culm S. 328). 1454 wurde er in den aus 12 Personen bestehenden Beirat gewählt (Mitt. 13, S. 74). Über die Rolle, di er seit 1454 spielte, vgl. Mitt. 3, S. 74 f. Ein Register des Lucas Waczelrode wird genannt in der Rechnung des Theudenkus (Fontes 33 B 383). |
||||||||||||||
|
|
[Wenn Sie die Fußnoten-Nummer anklicken, führt Sie dies zurück zu Ihrem Ausgangspunkt.] | |||||||||||||
2) In Heft 13 der Mitteilungen steht bei 7) und 8) die falsche Lesart Hirco (Herco) statt Girco ( Gerco). |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
zurück: |
||||||||||||||
|
weiter: |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() HEIM@THORN
HEIM@THORN
![]() Editorial - Inhalt
Editorial - Inhalt
![]() Die Thorner Stadtniederung - Inhalt
Die Thorner Stadtniederung - Inhalt
![]() Das Buch- Inhalt
Das Buch- Inhalt
![]() Die Quelltexte - Inhalt
Die Quelltexte - Inhalt
![]() Der Anhang - Inhalt
Der Anhang - Inhalt
![]() Die Links
Die Links
![]() Mein Thorn
Mein Thorn